Vom 17. – 19. Juni 2011 findet im im Autonomen Zentrum Köln (Wiersbergstr. 44, Köln – Kalk) der Kongress für autonome Politik 2011 statt. Unter anderem ist eine Debatte über die Bedeutung und Rolle der Militanz geplant. Dazu folgender Beitrag.
»Wir haben Fehler gemacht, wir legen ein volles Geständnis ab ...Wir sind sachlich gewesen, wir sind gehorsam gewesen, wir sind wirklich unerträglich gewesen... Wir haben uns den Immatrikulationsbestimmungen unterworfen. Wir haben Formulare ausgefüllt, die auszufüllen eine Zumutung war.... Wir haben uns durch schlechte Noten kleinkriegen lassen, wir haben uns durch gute Noten wieder aufmöbeln lassen, wir haben es mit uns machen lassen.... Wir haben in aller Sachlichkeit über den Krieg in Vietnam informiert, obwohl wir erlebt haben, daß wir die unvorstellbarsten Einzelheiten über die amerikanische Politik in Vietnam zitieren können, ohne daß die Phantasie unserer Nachbarn in Gang gekommen wäre, aber daß wir nur einen Rasen betreten zu brauchen, dessen Betreten verboten ist, um ehrliches, allgemeines und nachhaltiges Grauen zu erregen... Da sind wir auf den Gedanken gekommen, daß wir erst den Rasen zerstören müssen, bevor wir die Lügen über Vietnam zerstören können, daß wir erst die Marschrichtung ändern müssen, bevor wir etwas an den Notstandsgesetzen ändern können, daß wir erst die Hausordnung brechen müssen, bevor wir die Universitätsordnung brechen können. Da haben wir den Einfall gehabt, daß das Betretungsverbot des Rasens, das Änderungsverbot der Marschrichtung, das Veranstaltungsverbot der Baupolizei genau die Verbote sind, mit denen die Herrschenden dafür sorgen, daß die Empörung über die Verbrechen in Vietnam, über die Notstandspsychose, über die vergreiste Universitätsverfassung schön ruhig und wirkungslos bleibt.« (Peter Schneider am 5. Mai 1967 vor der Vollversammlung aller Fakultäten der Freien Universität Berlin)
Peter Schneider hatte mit seiner Rasen-Rede ein prägnantes Bewegungsbild der 68er Revolte gezeichnet. Es ging darum, den Rasen zu betreten, um auf das Eigentliche zu sprechen zu kommen. Das Duckmäusertum, die Gleichgültigkeit gegenüber Krieg und postfaschistischer Kumpanei sollte in der Raserei über die Missachtung eines Verbotsschildes: ›Rasen betreten verboten‹, sichtbar gemacht werden. Um dieses Heer aus grauen Mäusen aus der Fassung zu bringen, reichte es vollkommen, die Hausordnung zu stören, Regeln zu übertreten, Konventionen zu missachten. Die schweigende Masse geriet außer sich, kam (wieder) zu sich (von ›Geht doch rüber, wenn es euch nicht passt‹ bis hin zu ›Euch hat man vergessen zu vergasen‹) und die veröffentlichte Meinung dirigierte das ›gesunde Volksempfinden‹ mit altbekannten Instrumenten. Viele Handlungen waren von diesem provokativen Charakter geprägt: das eigene, ungepflegte, gammlige und schlapprige Aussehen, die langen Haare, das leistungsmüde, der Lust frönende Hippie-Dasein... viele Aktionen hatten symbolische Bedeutung wie die Pudding-Attacke auf den US-Vizepräsidenten Hubert H. Humphrey 1967 in Berlin, die von Regierung und Medien zum ›Pudding-Attentat‹ aufgerüstet werden musste, um mit dem Ruf nach der Ordnung die Stimmen über einen verbrecherischen Krieg (in Vietnam) zum Schweigen zu bringen. Was sich die Bewegung intuitiv aneignete, wurde später als ›kontrollierte Regelverletzung‹ - ein ziviler Ungehorsam, der die (Straf-)Gesetze nicht übertreten will, sondern davor Halt macht.
Was eigentlich nur helfen sollte, den Muff unter den Talaren zu lüften, um ein wenig freier atmen zu können, löste eine blutige Reaktion aus.
Mit der Ermordung von Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 während einer Anti-Schah-Demonstration in Berlin durch den Polizeibeamten Kurras, spätestens mit dem Anschlag auf Rudi Dutschke am 11. April 1968, der die Hetzkampagne der BILD-Zeitung und den darin kaum noch verhüllten Mordaufruf gegen ›rote Rädelsführer‹ zuende führte, trat ein Wendepunkt ein. Was für viele der damals Beteiligten ein bescheidenes demokratisches Anliegen war, wurde auf Seiten der Reaktion mit blutigem Ernst beantwortet.
Im konkreten und ideellen Kontext dieser Ereignisse stehend, markierte die damalige Konkret-Redakteurin Ulrike Meinhof den entscheidenden Scheidepunkt:
»Protest ist, wenn ich sage, das und das passt mir nicht. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, dass das, was mir nicht passt, nicht länger geschieht.«
Die Springer-Blockade, der Versuch, die Ausgabe dieses Hetzblattes zumindest für einen Tag zu verhindern, stand im Geist dieses Satzes. Die Make-love-not-War-Stimmung war verflogen, die Verhältnisse hatten sich als hartnäckig und im Kern nicht verhandelbar erwiesen. Dennoch blieb diese Einsicht seiner Zeit und seinen ProtagonistInnen voraus. Und doch blieb er nicht ohne Wirkung.
Während viele aus Resignation, Ernüchterung und Angst ins alte Leben zurückkehrten, einige den ›Marsch durch die Institutionen‹ antraten, zogen andere radikale Konsequenzen aus dieser ersten breiten Protestbewegung im Nachkriegsdeutschland.
Das lag vor allem am veränderten Blick auf diese Gesellschaft. Hatten die 68er noch in der Mehrheit geglaubt und gehofft, dass man im Rahmen der Verfasstheit Veränderungen, Reformen erreichen kann, war dieser Glaube Anfang der 70er Jahre bereits gewaltig erschüttert.
›Revolutionärer Kampf‹ nannte sich die stärkste Gruppierung in Frankfurter Häuserkampf, ihre Zeitung trug den alles andere als bescheidenen Titel: ›Wir wollen alles‹. Was man den 68ern in aller Regel nur unterstellte, wurde Anfang der 70er Jahre oft bewusst und gewollt in die Tat umgesetzt. Man begnügte sich nicht länger mit dem Wunsch, es möge im Kapitalismus gerechter zugehen, man wollte nicht länger an den Gemeinnutz des Eigentums (›Eigentum verpflichtet‹...) appellieren. Man wollte nicht länger den Leerstand von Häusern, eine Stadtpolitik, die der Business Class alle Wünsche von den Lippen abliest, als bedauerliche Fehlentwicklungen beklagen. Man sah darin System... Das System macht keinen Fehler, es ist der Fehler.
Man wollte nicht länger vor all dem und der Polizei weglaufen...
Vom Protest zum Widerstand
Nach der stundenlangen Straßenschlacht nach der Räumung des Grüneburgweg 113, vor allem nach der militanten Verteidigung des besetzten Hauses im Kettenhofweg, wurde gerade von jenen die Gewaltfrage gestellt, für die die Androhung und Anwendung von Gewalt keine Frage ist. Die Frage nach der Gewalt richtete sich also nicht an alle, sondern an jene, die sich in erster Linie vor staatlicher Gewalt, vor Polizeiübergriffen schützen wollten, anstatt sich verprügeln zu lassen - weit davon entfernt, selbst anzugreifen. Die Häuserkampfbewegung wurde unter Beschuss genommen. Wie steht sie zur Gewalt? wurde unentwegt gefragt, Fragen von Hutträgern, die ihr Gegenüber dazu auffordern, den Hut abzunehmen, weil dies der Respekt gebiete. In ähnlicher Manier wurde von Politrockern, Gewalttätern in den Reihen des Häuserkampfes gesprochen, die diese isolieren, von denen sie sich distanzieren müsse.
Die Gewaltfrage entpuppte sich als eine Frage der Bewaffneten an die Unbewaffneten.
Nur mühsam konnte sich die Gewaltfrage hinter dem verstecken, was eigentlich geschützt und nicht in Frage gestellt werden durfte: das staatliche Gewaltmonopol.
Das staatliche Gewaltmonopol garantiert nicht den Frieden, sondern den Unfrieden
Diese Idee, alle BürgerInnen zu entwaffnen und dem Staat ein Gewaltmonopol zuzusprechen, ist in der Staatengeschichte recht jung. Die bürgerlichen Revolutionen, auf die alle europäischen Regierungen mit Stolz verweisen, hatten sich in aller Regel mit einer gehörigen Portion Gewalt gegen die Feudalherrschaft durchgesetzt. Kaum an der Macht schwante der siegreichen Klasse, dass ihr das gleiche Schicksal widerfahren könnte und kam sogleich auf eine geniale Idee. Um ihre Macht zu sichern, schlug sie in Unternehmermanier einen Gesellschaftsvertrag vor - über den nie wirklich abgestimmt wurde. Die Idee war auf den ersten Blick beeindruckend: Der Staat wacht als neutrale, über den Interessen stehende Instanz darüber, dass die unterschiedlichen, gesellschaftlichen Interessen fair und gerecht ausgetragen werden. Der/die Bürger verzichten dabei auf die Ausübung von Gewalt und der Staat garantiert, dass diese Interessen frei und souverän eine Übereinkunft erzielen können. Der Trick an diesem Gesellschaftsvertrag ist schnell durchschaut: Die Gleichheit der BürgerInnen gilt nur in politischem Sinne, insoweit sie alle eine (Wahl-)Stimme bekommen, um ihre Interessen vertreten zu lassen. Also einmal in vier Jahren. An allen anderen Tagen bestimmt ihr ökonomische Ungleichheit ihren Alltag. Ein Hausbesitzer kann sich seine Mieter aussuchen, aber nicht umgekehrt, ein Unternehmer kann seinen Angestellten feuern, aber die Lohnabhängigen nicht ihren Chef. Ein Ladenbesitzer kann die Preise seiner Waren erhöhen, aber der/die Käufer nicht den Preis der Waren reduzieren... Und selbst die politische Freiheit stellte sich schnell als Trugbild heraus, denn eine Partei, die Millionen an Spendengeldern aus der Business Class bekommt, hat ganz andere Chancen als eine Partei, die von der ökonomischen Klasse nicht bedacht wird. Wenn also ein Staat nicht die Summe seiner WählerInnen ist, sondern die Summe des eingesetzten Kapitals, ist ein solcher Staat nicht neutral, sondern politischer Verwalter und Exekutant jener Kapitaleigner, die ihre geringe Zahl an Wählerstimmen durch das maximale Stimmrecht des Geldes zu kompensieren verstehen - im Zweifelsfall mithilfe staatlicher Gewalt.
Wenn also der Staat, seine Staatsparteien die Gewaltfrage stellen, dann ist damit keine offene Diskussion gemeint, sondern eine Drohung.
Die Gewaltfrage wird aber nicht nur von außen an eine Bewegung herantragen, sie ist immer auch eine Frage der Bewegung selbst. Auch im Frankfurter Häuserkampf wurde immer wieder heftig darüber gestritten, wann Gegengewalt notwendig, wann Gegengewalt zur Durchsetzung politischer Ziele richtig ist. In dieser und in allen folgenden Bewegungen wurde vieles diskutiert. Manche glauben, dass ein Stein wichtiger ist als ein Flugblatt. Manche halten den Wurf eines Molotowcocktails für revolutionär, das Halten einer Rede für reformistisch. Manche sehen im Bestehen auf und im Erleben von Gegen-Gewalt ein befreiendes Moment, andere eine gefährliche, geschlechtsspezifische (Selbst-)Überschätzung. Manche sehen in der Gegen-Gewalt eine Möglichkeit, andere eine gefährliche Form der Selbstjustiz. Manche sehen in der Gegengewalt eine politische Notwendigkeit, andere spüren nur ihre Angst.
Der Frankfurter Häuserkampf, die Diskussionen, die darum geführt wurden, haben keine eindeutigen, sicheren Ergebnisse zurückgelassen. Aber sie haben dazu beigetragen, zu erkennen, das die Gewaltfrage nicht unsere Frage ist, also nicht mit einem Bekenntnis für oder mit der Ablehnung von Gewalt zu beantworten ist.
Zu aller erst hieße es, die Gewaltfrage auf die Füße zu stellen und zu Ulrike Meinhofs Feststellung zurückzukommen:
»Protest ist, wenn ich sage, was mir nicht passt. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, dass das was mir nicht passt, auch nicht geschieht.«
Wer sich dieser Unterscheidung stellt, wer diese teilt, fragt nicht mehr nach der Gewalt, sondern findet sie vor.
Was also tun, damit das, was uns nicht passt, auch nicht geschieht? Was tun, wenn jene, denen alles passt, alles veranlassen, damit sich daran nichts ändert?
›Macht kaputt was euch kaputt macht‹ ( Ton Steine Scherben/1970)
Radios laufen, Platten laufen,
Filme laufen, TV's laufen,
Reisen kaufen, Autos kaufen,
Häuser kaufen, Möbel kaufen.
Wofür?
Refrain:
Macht kaputt, was euch kaputt macht!
Macht kaputt, was euch kaputt macht!
Züge rollen, Dollars rollen,
Maschinen laufen, Menschen schuften,
Fabriken bauen, Maschinen bauen,
Motoren bauen, Kanonen bauen.
Für wen?
Refrain:
Bomber fliegen, Panzer rollen,
Polizisten schlagen, Soldaten fallen,
Die Chefs schützen, Die Aktien schützen,
Das Recht schützen, Den Staat schützen.
Vor uns!
Refrain:
Macht kaputt, was euch kaputt macht!....
Diesem Song von Ton Steine Scherben aus dem Jahr 1970 gelingt es, mit dem Stakkato weniger Worten Bilder entstehen zu lassen, die die Wut einfangen, mit der viele ihre Eltern, ihre Schule, ihre Arbeit, ihren Alltag hinter sich lassen wollten. Eine Wut, die sich an so vielem entzündet, dass man gar nicht weiß, wo man zuerst zurück-, zuerst zuschlagen sollte. Dieser Song ist alles andere als eine Hymne auf die Gewalt, sondern zu aller erst ein Schrei gegen die Ohnmacht, ein Schrei, all dies nicht länger hinzunehmen, zu ertragen, auszuhalten. Ein Song, der dazu aufruft, nicht länger zu warten, bis man wieder Opfer wird, sondern aufzustehen, zuzuschlagen, bevor man ein weiteres Mal getreten wird.
Nur einmal tauchen schlagende Polizisten auf, in allen anderen Fällen werden Verhältnisse blitzlichtartig sichtbar, die Ohnmacht, Stumpfsinn, Gleichgültigkeit und Apathie erzeugen und brauchen.
Wie soll man das kaputt machen?
Soll man Autohäuser, Reisebüros, Möbelhäuser anzünden, Fernseher aus dem Fenster werfen, Dollars verbrennen, Chefs verprügeln, Panzer in die Luft jagen und Bomber vom Himmel holen?
Zwischen all dem, was einen kaputt macht und dem Refrain klafft eine große Lücke.
Noch größer wird die Lücke, wenn der Refrain eingelöst ist und alles kaputt ist, was uns kaputt gemacht hat. Was kommt danach, was soll danach kommen?
Mit der Behauptung von GegenGewalt ist immer mehr gemeint als sich der herrschenden Gewalt nicht zu beugen. Will sie nicht gleichziehen, muss sie darüber hinausweisen, muss die in ihr eingeschriebene Verneinung auch sichtbar machen.
GegenGewalt, Militanz muss also mehr als eine Rechtfertigung sein, mehr sein als eine Entschuldigung, der Gegner habe uns keine andere Wahl gelassen. GegenGewalt heißt nicht, einen günstigen Augenblick abzupassen, wo wir mehr sind, wo wir mit gleicher Münze heimzahlen, also gleichziehen können.
Mit GegenGewalt ist mehr gemeint, als sich dem in den Weg zu stellen, sich nicht vom eigenen Weg abbringen zu lassen. Manchmal ist es richtig, auszuweichen, der Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Ein anderes Mal ist es richtig, den Zeitpunkt der Konfrontation selbst zu wählen.
GegenGewalt, Militanz ist keine Frage des Mutes, keine Frage des Sachschadens, keine Frage der Laufwege und keine Frage der Härte. Es gibt weder die Mittel, woran man Militanz erkennt, noch Mittel, die per sé friedlich, gewaltfrei sind. Militanz erkennt man nicht an den richtigen Mitteln, sondern an einer Lebenshaltung, an einer politischen Grundhaltung.
Dafür gibt keine ›richtigen‹ Mittel. Es gibt Reden, die gerade völlig fehl am Platze sind, Flugblätter, die im falschen Moment geschrieben werden, Steine, die im falschen Moment aufgehoben werden, in die falsche Richtung fliegen können.
Es gibt also keine emanzipatorischen Mittel, sondern nur Mittel, die sich an ihren Zielen messen, sich über ihre Ziele rechtfertigen müssen.
Die Behauptung von GegenGewalt, von Gegenmacht ist richtig und immer riskant - nicht nur mit Blick auf einen Staat, der sich das Gewaltmonopol nicht streitig machen lassen will. Sie ist riskant, weil sie immer in Gefahr ist, etwas mit (Waffen-)Gewalt zu überspringen, was nur als sozialer und gesellschaftlicher Prozess möglich ist. Wer dieses Verhältnis umkehrt, hat kein höheres Niveau der Auseinandersetzung erreicht. Er hat sich der Logik staatlicher Macht genähert: »Gegengewalt läuft Gefahr zu Gewalt zu werden, wo die Brutalität der Polizei das Gesetz des Handelns bestimmt, wo ohnmächtige Wut überlegene Rationalität ablöst, wo der paramilitärische Einsatz der Polizei mit paramilitärischen Mitteln beantwortet wird.« (Ulrike Meinhof, Mai 1968)
Wolf Wetzel 2011
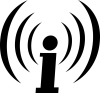

Hey Wolf...
Mal nen link zum Audiovisuellen:
http://www.youtube.com/watch?v=UwE8dlRnsio
sehr richtig
danke für den text
er ist zwar eine wiederholung aller debatten bringt es aber in kürze nochmal auf den punkt
also!