Ist Gera eigentlich Provinz?
Nachdem unser Aufruf veröffentlicht wurde, gab es durchaus berechtigte Kritik an unserem Titel. Gera sei doch gar nicht so wirklich Provinz und unser Aufruf wäre eher als Jammern auf hohem Niveau zu verstehen. Wir müssen dieser Kritik an dieser Stelle durchaus Recht geben: mit knapp 100 000 Einwohner*innen ist Gera mit Sicherheit nicht die provinziellste Stadt in Thüringen. Doch darum soll es auch gar nicht gehen: nicht die Zahl der Einwohner*innen oder die Größe der Stadt war für uns ausschlaggebend für diese Bezeichnung. Provinz hat in unserem Verständnis mit solchen demographischen Merkmalen recht wenig zu tun.
Es soll hier also nicht darum gehen, Solidarität zu erhaschen indem wir die hiesigen Verhältnisse stilisieren. Vielmehr wollen wir Verbindungen ziehen, zwischen dem was in den wirklich ländlichen Regionen passiert und dem, was wir hier alltäglich erleben und vor allem dem, was uns von Strukturen der Großstädte und Metropolen unterscheidet.
Auch wollen wir diese Demonstration als Anlass zur Vernetzung verstehen, um denen beizustehen die auf noch weniger Infrastruktur zurückgreifen können. Hier soll euch eine Möglichkeit geboten werden in Kontakt zu kommen und Beziehungen zu knüpfen, die auch abseits des heutigen Tages Bestand haben. Es soll eine Plattform bereitgestellt werden um den Zuständen etwas entgegenzusetzen und Position zu beziehen.
Doch wie gestalten sich diese Zustände, wegen derer wir hier und heute auf die Straße gehen? Was sind die Probleme, die wir hier sehen und von denen wir denken, dass sie Teil der Probleme antifaschistischer Arbeit in der Provinz sind?
Viele von uns, die innerhalb dieser Zustände aufgewachsen sind und dennoch die Möglichkeit hatten sich wie auch immer progressiv zu sozialisieren, werden in einem Punkt wahrscheinlich zustimmen: Teil unseres Alltags waren schon immer Nazis, die sich meist ungehindert und unwiderspochen schon seit jeher positionieren konnten.
Sich gegen solch regressive Positionen zu stellen, stellt im Gegensatz zur relativen Anonymität der Großstadt hier immer auch eine Gefahr für Menschen da. Diese Athmosphäre stellt einen erheblichen Hinderungsgrund dafür dar, sich zu vernetzen und sich zu organisieren.
Auch die fehlenden Angebote der Jugendarbeit sind für regressive Bewegungen ein bedeutender Ansatzpunkt: so werden, sofern sie überhaupt vorhanden waren, Jugendclubs geschlossen und die Möglichkeiten sich aktiv einzubringen beschränken sich auf die Mitarbeit in der freiwilligen Feuerwehr oder im Heimatverein.
Dieses Klima der ständigen Gefahr und auch der Perspektivlosigkeit befördern zudem ein weiteres Problem, dem wir uns gegenübergestellt sehen:
Im Gegensatz zu den großen Städten, in denen politische Bewegungen und Gruppen historisch gewachsen sind, will ein Großteil der Menschen, die hier aufwachsen vor allem Eines: so schnell wie möglich weg.
Die Großstadt verspricht Anbindung an bereits Bestehendes hält Zukunftsaussichten bereit und ist für viele der Ausweg, nach dem sie sich seit langem sehnen. Für diejenigen, die Anfeindungen ausgesetzt waren bietet sie vor allem erst einmal Sicherheit.
Doch was passiert ist, dass jedwede Möglichkeit, die Situation in den Dörfern und Kleinstädten tatsächlich zu verändern, zerstört wird. Diese Zustände sind es, die wir heute thematisieren wollen und die eben auch auf Gera zutreffen.
Wie soll sich aber ein Ausweg aus dieser Situation gestalten? Den Menschen zu sagen: bleibt alle hier und es wird besser, scheint eine unsinnige Strategie. Denn durch Worte und Versprechen, lässt sich niemand die Angst vor Bedrohung ausreden oder die Tristesse überwinden, die sich als Schleier über den Alltag legt. Vielleicht hilft es hier, den Begriff antifaschistischer Arbeit unter anderen Gesichtspunkten zu betrachten und für die weiteren Kämpfe neu zu besetzen.
Antifaschistische Arbeit als politische Sozialarbeit - Teilhabe als Grundprinzip
Ohne dabei alle bestehenden Strukturen in Misskredit bringen zu wollen, so zwängt die Lage der antifaschistischen Linken dennoch die Betrachtung eiens zentralen Problems auf. Innerhalb der bestehenden gesellschaftlichen Strukturen liefert die Selbstzuordnung zum "antifaschistischen Lifestyle" vor allem Eines: eine Möglichkeit zur Abgrenzung von dem, was mensch als falsch empfindet und damit auch die Möglichkeit über eine solche Positionierung Selbstwert zu generieren. Dies kann nicht als grundsätzlich falsch angesehen werden, denn oftmals ist dies die Möglichkeit sich nicht komplett in der Verwertungslogik zu verlieren.
Doch unterliegt auch dieser Weg der Gefahr, genau dass zu bewirken, was mensch selbst eigentlich nicht will: Szenezusammenhänge produzieren genauso Ausschluss und lassen ebenso Menschen auf der Strecke wie die Strukturen, die sie eigentlich kitisieren wollen.Wer die Codes nicht kennt, wer nicht Glück hat über persönliche Beziehungen dazuzukommen, wer in Ortschaften aufwächst, in denen Politik abseits des Stammtisches nie ein großes Thema war, hat, gelinde gesagt, ein Problem.
Antifaschismus läuft daher Gefahr zum Konsumprodukt zu verkommen und Mittel der Selbstidealisierung und der Abgrenzung von Anderen zu werden. Vielleicht sollte das Augenmerk vor allem in der "Provinz" auf bestimmten Grundprinzipien sozialer Arbeit liegen:
Nämlich darauf offene Angebote zu schaffen, an denen Menschen teilhaben können und die erwähnte Tristesse durchbrechen können. Angebote, die Menschen aus ihrer Hilflosigkeit herausholen und ihrem Gefühl des "Nichts-wert-Seins" entfliehen können. Angebote bei denen sie erfahren können, was es heißt selbst wirksam zu werden, was es heißt teilzuhaben.
Das heißt nicht, dass darüber der politische Anspruch verloren gehen sollte - im Gegenteil - diese Grundprinzipien sollten einem Anspruch an progressive Politik eigentlich innewohnen. Denn die Grundlage für Menschen, überhaupt erst einmal politisch wirksam zu werden, liegt nicht beim Gang an die Wahlurne sondern darin, sie darin zu bestärken aktiv zu werden.
Empowerment können wir hier als Prinzip der sozialen Arbeit entlehnen und ebenso zum Grundbestandteil des Alltaghandelns machen. Denn ohne dieses besteht eben auch antifaschistische Arbeit aus hierarchisch geprägten Prozessen die sich auf Wissens- oder eben auch Selbstwertunterschieden begründen.
Und dadurch besteht auch die Gefahr, dass sich antifaschistische Strukturen immer wieder nur selbst bestätigen un verkrusten, statt mal über die Mateflasche hinweg zu schauen, welche Menschen denn wirklich täglich strugglen.
Der Wunsch nach polit. Freiräumen heißt unter diesen Bedingungen eben auch nicht "Eignet euch die Szenecodes an und lernt Antifaschistinnen zu sein, dann kommt ihr auch rein“ sondern: "Hier ist ein Raum in dem ihr eure Bedürfnisse kennenlernen und verwirklichen könnt und in dem ihr Hilfe und Solidarität erfahrt." Nur so ist es möglich, dass Menschen begreifen, dass es nicht notwendig ist, sich über Gruppenzugehörigkeiten zu definieren und andere auszugrenzen. Und nur über einen solchen offenen Raum kann sich progressive Politik aus der Falle der Selbstbestätigung befreien.
Was also tun? - Nazis ihre Strategien vereiteln.
Doch ist es nicht genau das, was Nazis schon seit mehreren Jahren erfolgreich versuchen? In den strukturschwachen Regionen Fuß zu fassen und die Deutungshoheit zu gewinnen? Wahrscheinlich ja. Dennoch kann im Gegensatz zu regressiven Strukturen eine Haltung besetzt werden, die ihnen nicht möglich ist: der grundlegende Gedanke der Gleichwertigkeit von Individuen und der Versuch Gesellschaft nicht nur für bestimmte Gruppen, sondern für alle ins Positive zu verändern.
Lasst uns also nicht nur zu Demos auf die Straße gehen, sondern auch im Alltag. "Reclaim the streets" kann vieles sein:
Graffiti Workshops oder Straßenfeste, Guerilla- Raves oder Wanderungen, Vorträge oder Konzerte, Lesezirkel oder eben auch mal unangemeldete Küfas im Kiez. Aber auch die Hilfe für diejenigen, die für so etwas gerade nicht die Energie besitzen: Sei es die Begleitung zur Anhörung beim BAMF für Geflüchtete Menschen oder die Hilfe beim Jobcenter für Hartz4 EmpfängerInnen.
Sie müssen erst einmal wissen, dass sie nicht allein sind und sich in sich selbst sicher genug fühlen um überhaupt politisch aktiv werden zu können.
Begegnen wir uns auf Augenhöhe und kämpfen wir zusammen: Gegen die Tristesse, gegen die alltagsscheisze und für das gute Leben für alle!
Oder, um es mit den Worten der Antifaschistischen Gruppen des Vogtlandes zu sagen:
Die Demo in Gera ist wichtig. Sie ist ein Akt der Solidarität, die den dort verbliebenen Genoss_innen den Rücken stärkt, sie animiert weiter zu machen.
Darüber hinaus müssen wir wieder Bewegung werden, müssen wir unser Denken wieder in den Dienst der Unterdrückten stellen.
Kurz wieder linke Politik für die und mit denen machen, die den Zumutungen von Staat, Nation, Kapital und Patriarchat so grausam ausgeliefert sind.
Dazu ist es als erstes notwendig, diesen Menschen zuzuhören, ja sie erst einmal kennen zu lernen, die Not sich wieder – wortwörtlich – vor Augen zu führen,
um dann evtl. gemeinsam kämpfen zu können. Ein schwieriger Weg, aber alle mal Erfolg versprechender, als protektionistische „Strafexpeditionen“ ins unterbelichtete Hinterland zu organisieren.
Doch lasst uns auch zum Schluss positiv nach vorn blicken:
Es ist nicht so, dass all die Arbeit jetzt gerade noch nicht passiert. Es gibt die Ansätze eben dieser Arbeit fast überall, ob hier in Gera, in Plauen, in Hermsdorf, in Eisenberg, in Lugau und in vielen anderen Orten. Deswegen ist, um zum Thema der Demo zurückzukommen, die Vernetzung so uheimlich wichtig.
So können wir sichtbar machen, was wir alle tagtäglich im Kleinen leisten und damit die Grundlage schaffen für das besser ganze.
Für das gute Leben für alle.
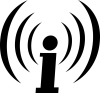

Bilder des Tages
Oskar Schwartz
Simon Telemann
Caruso Pinguin