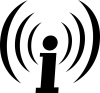Polizisten nutzen mit Einschüchterung, Diskriminierung und sexueller Nötigung ihre Machtposition aus. Betroffene kritisieren, dass Sexismus zum „Repressionsrepertoire“ der Polizei gehört
Eine diese Woche publizierte Dokumentation des Feministischen Instituts Hamburg beschreibt sexistische Erfahrungen mehrerer Frauen im Kontakt mit Polizeibeamten. Die Vorfälle drehen sich um Hilfeersuchen auf einer Polizeiwache ebenso wie im Rahmen von Personalienfeststellungen, Ingewahrsamnahmen oder Festnahmen. Die Verfasserinnen konstatieren eine „häufige Form gesellschaftlich geduldeter sexistischer Verhaltensweisen“. Verschärfend kommt hinzu, dass die Beteiligten sich in einer Situation ungleicher Hierarchien und Abhängigkeitsverhältnisse wiederfinden. Ähnliche Erlebnisse sollen nun in einem Blog gesammelt werden.
Das erste Fallbeispiel von „Polizei und Sexismus: Erfahrungen mit den Vertreter*innen der Exekutive“ beschreibt die Meldung einer exhibitionistischen Handlung auf einer Polizeiwache. Der diensthabende Beamte konstatiert brüsk, dass der Vorfall zwei Tage zurück läge und will keinen Vorgang anlegen. Erst als eine begleitende Person darauf aufmerksam macht, dass der Betroffenen derart Schuldgefühle eingeredet werden, nimmt er den Fall auf. Das Gespräch findet hinter einem Raumteiler statt: Alle Polizisten, aber auch Wartende auf der Wache können mithören. Statt Fragen zum Tathergang zu stellen, verfällt der Polizist in einen belehrenden Ton: Die Betroffene hätte sofort die Polizei anrufen sollen. Ungünstig sei, dass sie über Kopfhörer Musik gehört habe, denn so hätte sie den Exhibitionisten nicht verstehen können. Am Ende gibt er der anzeigenden Frau eine Mitschuld (das sogenannte „Victim Blaming“) und versteigt sich zur paternalistischen Phrase, was „eine junge Frau um diese Uhrzeit eigentlich nachts allein auf der Straße“ machen würde.
Eine weitere dokumentierte Situation spielte sich anlässlich einer politischen Blockadeaktion ab, bei der eine Frau in Gewahrsam genommen wurde. Die Betroffene muss eine längere Zeit mit männlichen Polizisten in einem Waldstück verbringen. Zunächst wird sie mit Bemerkungen über ihre Kleidung verhöhnt, die Frage nach Feuer für ihre Zigarette wird mit der Drohung des Einsatzes von Pfefferspray quittiert. Am Ende wird ihr unterschwellig mitgeteilt, dass sie auch hätte vergewaltigt werden können: „Seien Sie mal froh, dass meine Kollegen Sie eben nicht ‘gefrühstückt’ haben“. Die Forderung nach Herausgabe des Namens und der Dienstnummer des Polizisten wird wie üblich ignoriert.
Diese Erfahrung deckt sich mit jener, die eine weitere Autorin über einen Gefangenenbus berichtet. Nachdem die Tür der engen Zelle geöffnet wird, werden die weiblichen Insassen mit „Nun macht mal hin! Die anderen Mädchen waren auch alle hübsch und willig” angeschrien. In einer anderen Situation in Polizeigewahrsam wollen männliche Polizisten der Bitte nicht nachkommen, von einer weiblichen Polizistin auf die Toilette begleitet zu werden. Wieder wird mit dem Spruch, der männliche Polizist könne doch ihren Tampon wechseln, ein Übergriffsszenario in den Raum gestellt.
Sexismus gehört zum Repressionsrepertiore der Polizei
Nur selten wird polizeilicher Sexismus überhaupt thematisiert. Die sogenannte „Antisexist Contact- and Awarenessgroup“ hatte hierzu etwa nach dem G8-Gipfel in Heiligendamm Zeugen und Zeuginnen gesucht. Das Thema sollte damit „politisch ans Tageslicht“ geholt werden und in einem Untersuchungsausschuss thematisiert werden, der aber nie zustande kam. Die Aktivistinnen gehen in ihrem Aufruf insbesondere auf Sexismus, sexualisierte Gewalt und Vergewaltigungen als Praktiken von Polizei und Armee als staatliche „Zwangsinstitutionen“ ein. Sie würden bewusst eingesetzt, „um die symbolisch ohnehin schon inszenierte Demütigungs- bzw. Unterwerfungspraxis zu verstärken“.
Derart ist es etwa 2011 nach dem polizeilichen Überfall auf eine Schlafstätte von Demonstranten bekannt geworden: Im tagelangen Polizeigewahrsam wurden Frauen unter Schlägen sexuell belästigt und mit Vergewaltigung bedroht.
Britische Spitzel wurden kürzlich von Aktivstinnen des „emotionalen und sexuellen Missbrauchs“ bezichtigt. Die Polizisten hatten bis zu neun Jahre sexuelle Beziehungen genutzt, um linke Bewegungen auszuforschen. In allen bekannten Fällen handelte es sich um männliche Täter.
In Heiligendamm reichen die bis dahin dokumentierten Vorkommnisse von der Verweigerung von Tampons über Kontrollen, bei denen Betroffene körperlich belästigt wurden. Neben anzüglichen Bemerkungen und Fotos von vollständig oder halb entblößten Körpern hat es demnach auch Androhungen von Vergewaltigung in Gefangenensammelstellen gegeben. Die „Antisexist Contact- and Awarenessgroup“ riet wegen einer befürchteten „sekundären Traumatisierung“ häufig von Anzeigen ab.
Oury Jalloh – Das war Mord
Die Verfasserinnen von „Polizei und Sexismus: Erfahrungen mit den Vertreter*innen der Exekutive“ weisen ebenfalls darauf hin, dass es sich nicht nur um den sexistischen „Normalzustand“ der Gesellschaft handele. Stattdessen nutzten die Polizisten ihre Machtposition unverfroren aus. Die Folge sind Nötigung, Einschüchterung und Diskriminierung. Überdies zeigen die Beispiele, wie Sexismus zum „Repressionsrepertoire“ der Polizei gehört.
Damit ähneln die Vorfälle dem offen zur Schau gestellten Rassismus in polizeilichen Amtsstuben, wie er kürzlich im Jahreskalender der Bayerischen Polizeigewerkschaft offenkundig wurde. Eine Person mit dunkler Hautfarbe wird dort mit übertrieben großer Nase und dicken Lippen dargestellt. Im schmerzhaften Polizeigriff wehrt er sich gegen den Begriff „Verdunkelungsgefahr“, den er als offensichtlich rassistische Anspielung interpretiert. Die Motive spiegelten den „Berufsjargon“ bayerischer Polizisten, kommentierte der Landesvorsitzende der Bayerischen Polizeigewerkschaft.
Hier drückt sich ein deutscher Rassismus aus, der auch in Polizeigewahrsam tödlich endet: Immer noch ist ungeklärt, wie der in Deutschland lebende Oury Jalloh 2005 in einer Polizeizelle in Dessau verbrennen konnte. Anscheinend drehte der diensthabende Polizist einen Lautsprecher ab, um den in den Flammen sterbenden Sierra Leoner nicht hören zu müssen. Fraglich ist aber, wie dieser angesichts seiner mehrmaligen Leibesvisitation überhaupt ein Feuerzeug besaß und gefesselt die Matratze in Brand setzen konnte. Einige BeobachterInnen, die den immer noch andauernden Prozess begleiten, vermuten mit dem Slogan „Oury Jalloh – Das war Mord“ polizeilichen Vorsatz.
Täter von KollegInnen gedeckt
Die Dokumentation des Feministischen Instituts Hamburg kommt zu dem Schluss, dass rassistische und sexistische Verhaltensweisen im Korpsgeist der Polizei angelegt sind. Ihnen sei kein Fall bekannt, der eine Dienstaufsichtsbeschwerde nach sich zog oder zur Anzeige gebracht wurde. Bemängelt wird das Fehlen von Namen oder Dienstnummern. Auch die Weigerung anderer Polizistinnen oder Polizisten, einen beobachteten verbalen oder körperlichen Übergriff zu bezeugen, behindert die Verfolgung.
Letztlich ist aber die Funktion der Polizei in der Gesellschaft das größte Problem: So wird das Ausgeliefertsein als „hierarchisch angelegte Situation“ beschrieben, in der eine direkte Intervention unmöglich ist. Beim Anzeige erstatten sind Betroffene auf die Polizei angewiesen und zudem schambelastet oder traumatisiert. Als Verdächtige oder in Gewahrsam Genommene wollen sie die Situation womöglich nicht weiter eskalieren und verzichten auf das Kontern des sexistischen Übergriffs.
Zu einem ähnlichen Schluss kommt LesMigraS, eine Gruppierung aus der Berliner Lesbenberatung. In einem Tagungsband weist der Verein darauf hin, dass die Angst vor Gewalt durch Polizisten vor allem unter migrantischen Frauen verbreitet ist.
Trotzdem geben die Verfasserinnen von „Polizei und Sexismus: Erfahrungen mit den Vertreter*innen der Exekutive“ Hinweise zu den wenigen Interventionsmöglichkeiten. So sollen Betroffene bei Anzeigen auf der Polizeiwache immer eine Vertrauensperson mitnehmen. Bei spontan erlebter sexistischer Polizeirepression können Umstehende einbezogen werden. Abhängig vom Erlebten kann es ratsam sein, über das Erlebte in geschütztem Rahmen zu sprechen oder es aufzuschreiben – vielleicht auch auf dem hierzu eingerichteten Blog.