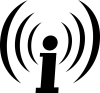Vor 50 Jahren erschien Georg Lukács’ Schrift »Zur Eigenart des Ästhetischen«, vor 90 Jahren seine Essaysammlung »Geschichte und Klassenbewusstsein«. Bemerkungen zum Doppeljubiläum. von Rüdiger Dannemann.
Es grassiert ein Vorurteil: Begriffe wie »Entfremdung«, »Verdinglichung« oder gar »Klassenkampf« könnten der Generation Youtube a priori und a posteriori nichts bedeuten. Der intelligente Fatalismus eines Byung-Chul Han etwa, der meint, heute gebe es nur noch Selbstausbeutung, und das »freie« Leistungssubjekt sei eben Opfer und Täter zugleich, bringt eine solche Einstellung auf den angenehm kulturpessimistischen Punkt. Gegen solchen Kulturpessimismus, den es in früheren Zeiten durchaus noch in weniger komfortablen Varianten Kritischer Theorie gab, erhebt das Werk des ungarischen Philosophen Georg Lukács wirkungsmächtig Einspruch.
Vor 90 Jahren erschien mit der Essaysammlung »Geschichte und Klassenbewusstsein« das Grundlagenwerk des später so genannten Westlichen Marxismus, dessen Repräsentanten (Antonio Gramsci in Italien, Karl Korsch in Deutschland, später die noch junge Kritische Theorie und nach dem Krieg Henri Lefebvre in Frankreich, Karel Kosík in der Tschechoslowakei, selbst noch in Maßen der junge Jürgen Habermas) einen reflektierten, undogmatischen Stil radikalen Philosophierens praktizierten.
In »Geschichte und Klassenbewusstsein« hatte Lukács 1923 eine Gegenwartsanalyse geliefert, die als ein theoretisches »Ereignis« (so nicht nur Slavoj Žižeks Einschätzung) zu verstehen ist – innerhalb der marxistischen Tradition und außerhalb. Er entwickelt das Bild einer durch die Warenproduktion geprägten gesellschaftlichen Totalität, deren fragwürdige Rationalität durchaus totalitäre Züge aufweist. Die kapitalistische Rationalität der Warenproduktion erfasst sämtliche Bereiche der Gesellschaft, so wird – wie schon Max Weber erkannte – etwa das Rechtssystem unter die neue Rationalitätsform subsumiert; nach Weber wird der Richter darin zu einer Art Paragraphenautomat. Auch Medien und Kultur werden ähnlich transformiert. Die kapitalismuskonforme Verdinglichung findet in den Bereichen Kultur und Medien sogar eine besondere Zuspitzung: Der Journalist etwa verkauft nicht »nur« seine Arbeitskraft wie der Proletarier, er macht sein Innenleben, seine Phantasie, seine ureigene intellektuell-emotionale Persönlichkeit zu einer Ware. Es gibt keine lebensweltlichen Bereiche, die sich vor der Okkupation durch die marktökonomischen Verwertungsimperative schützen können.
Lukács’ Beschreibung der kulturellen Folgen dieses Prozesses besitzt in unserer Zeit bedrückende Aktualität. Die Warenproduktion verändert nicht nur die Ränder der Kultur, sie betrifft und bedroht ihre Essenz: ihre Autonomie. Indem Kunst Teil des Marktes wird, den Maximen des Verwertungsprinzips subsumiert, ändert sich die Stellung des Künstlers in der Gesellschaft – er wird zum Produzenten und Verkäufer einer Ware. Er wird nicht anders als der gewöhnliche Lohnarbeiter zur Anpassung an die Logik eines externen sozialen Systems gezwungen, was auch für Struktur und Gehalt seines Produkts folgenreich ist. Lukács sieht dementsprechend die moderne Kunst in einer problematischen Krisensituation, in der Literaten und Künstler nach einer Neuorientierung suchen; in der notwendig gewordenen neuen Kultur muss die Autonomie der Kunst garantiert werden. Dies kann allererst der Fall sein beziehungsweise Realität werden in einer neuen Gesellschaft, in der Kunst nicht in die Kreisläufe der Verwertung eingezwängt ist. Das heißt für den ungarischen Dialektiker: in einer durch eine systemverändernde Revolution entstehenden neuen Welt.
Die Alternative dazu ist die Barbarei einer globalisierten Marktwirtschaft, in der die Menschen zu narzisstischen Verkäufern der Ware Arbeitskraft werden. In den 90 Jahren nach der Zeitdiagnose von »Geschichte und Klassenbewusstsein« ist deren Wahrheitsgehalt – leider – nicht im Verschwinden begriffen; nur ist das Existieren in der durch eine rationale Systemlogik geprägten Gesellschaft zur mal euphorisch, mal resigniert akzeptierten Alltäglichkeit geworden. Die Verdinglichungstheorie, die im Kern eine Kritik des modernen Autonomieverlusts ist, beschreibt noch immer die Lage der arbeitenden und der nicht arbeitenden Klasse im Zeitalter der Globalisierung, deren Chancenlosigkeit und (bislang) verpassten objektiven Möglichkeiten. Die heutigen Vorgänge im Bereich der neuen Technologien (und deren Anwendung in Wirtschaft und Politik – sei es durch Google und Amazon oder durch die Geheimdienste der USA und Großbritanniens) warten darauf, im Kontext einer erneuerten Verdinglichungstheorie aufgearbeitet zu werden. Das pure Behaupten von postmoderner Autonomie, das nicht nur in populären Lifestyle-Magazinen angesagt ist, überwindet das Problem nicht, sondern verdrängt es nur.
Dass Entfremdung nicht nur ins Zentrum einer sozialphilosophischen Theorie, sondern auch zum Kern ästhetischer Reflexion gehört, ist die These, die Lukács vor genau 50 Jahren in seiner monumentalen späten Ästhetik, die unter dem Titel »Die Eigenart des Ästhetischen« 1963 erschien, entwickelt hat. Lukács’ Ästhetik kreist um eine Theorie des Realismus, hat in den Begriffen Mimesis, Alltagsleben und Gattungsmäßigkeit ihre Leitbegriffe. Im System der menschlichen Tätigkeiten stellen Ethik und Kunst nicht identische, aber doch aufeinander bezogene Praxisformen dar. Sie sind rationale Weisen eines anthropomorphisierenden, auf Subjektivität bezogenen Umgangs mit Wirklichkeit und sondern sich so vom auf Objektivität zielenden wissenschaftlichen Diskurs ab. Durchaus konsequent wird die Katharsis zur Schlüsselkategorie des Rezeptionsverständnisses: Die letzte Funktion der Kunst ist die Evokation des Gefühls »Du musst dein Leben ändern«. In der Kunstrezeption wird der partikulare Mensch, das im Alltäglichen verankerte Individuum der Moderne, in den Sog der Entverdinglichung gezogen. Damit ist die Kunstrezeption eine Realisierung jener Substanzethik Lukács’, deren Kernstück die These ist, das Individuum könne sich vom Partikularen emanzipieren – ohne Selbstnegation. Das Telos der genannten grundlegenden Bausteine ist die Entfaltung des Selbstbewusstseins der Gattung, das heißt universalistischer Bewusstseinsstrukturen. Die in der verkürzenden Rezeption beliebte Reduktion auf einen Aspekt (etwa den des Realismus) ist unangemessen, zumal wenn der Begriff des Realismus nicht im kunstphilosophischen Sinn verstanden wird, sondern als Epochenbegriff. Die pluralistische Sphäre des Ästhetischen besitzt ihre Dignität, weil das Alltagsleben trotz seiner für die gesellschaftliche Reproduktion ausschlaggebenden Funktion auf ein Anderes, ihr gegenüber Autonomes angewiesen ist. Kunst ist darauf angelegt, als Unterbrechung des Alltagslebens dieses zu verändern.
Die »Mission« – Lukács scheut sich nicht vor der Verwendung dieses emphatischen Begriffs – großer realistischer Werke besteht darin, Platzhalter des Protests gegen Verdinglichung und Menschenverachtung zu sein, auch in nicht revolutionären Zeiten. Das hat nichts zu tun mit simpler Abbildung von Wirklichkeit: Es ist die kritisch-welthafte Aneignung der Wirklichkeit, deren Widersprüchlichkeit dargestellt wird in einer Weise, dass das »Idealbild einer von der Entfremdung befreiten, solidarischen Menschheit« konzipiert wird. Dieser Vorschein entspricht der Überzeugung: Auf jeder historisch-gesellschaftlichen Entwicklungsstufe sind Ausblicke auf eine Aufhebung der antagonistischen Widersprüche des Status quo möglich. In Lukács’ Formulierung: »Die Kunst (erweitert) den Kreis der Gedanken und Gefühle der Menschen, indem sie all das, was in einer historischen Lage objektiv enthalten ist, auf die Oberfläche der Erlebbarkeit bringt. Ob das ein Liebesgedicht oder ein Stillleben, eine Melodie oder eine Häuserfassade ist: es bringt das auf den Menschen Bezogene der Geschichte zum Ausdruck; das, was sonst vielleicht stummes Geschehen, dumpf hingenommene Faktizität gewesen wäre, enthält dadurch seine deutlich wahrnehmbare vox humana.« Insofern ist Kunst die auf Dauer gestellte Evokation von Empörung gegen erniedrigende und beleidigende Verhältnisse.
Wie heute Jaques Rancière ist Lukács der Überzeugung, dass Kunst nur dann existiert, »wenn man ihr ein Volk, eine Gesellschaft, ein Zeitalter, einen bestimmten Moment in der Entwicklung ihres kollektiven Lebens zuordnen kann«. Der Fortschritt in der Kunst besteht tatsächlich in der »ständigen Zunahme dessen, was sie vom Denken und Leben von allen möglichen Gegenständen aufnehmen kann und bearbeitet«, in der Integration von Wirklichkeitsaspekten, die bislang undenkbar beziehungsweise undarstellbar gewesen sind.
Rancière glaubt heute, dass die Kunst der Moderne dazu tendiere, die Besonderheit der Künste zu beseitigen und die Grenzen zu verwischen, die die Künste von der Alltagserfahrung trennen. Dem widerspricht Lukács’ vor einem halben Jahrhundert erschienenes großes Werk »Die Eigenart des Ästhetischen« mit Entschiedenheit: Der Prozess der Autonomiewerdung der Kunst hat seine Berechtigung – hier bestehen Übereinstimmungen zwischen den sonstigen Intimfeinden Adorno und Lukács – und ist Voraussetzung für die oben beschriebene Mission der Kunst. Eine Kunst, die sich dem Denken und Fühlen des Alltags, ob nun dezidiert popkulturell oder auch nicht, angliche, würde uns Zeitgenossen auch in der Kunstrezeption auf das Niveau der alltäglichen Verdinglichung reduzieren. Damit würde der kathartische Kern von Kunstproduktion und -rezeption verloren gehen: der kategorische Imperativ der Kunst, »Du musst dein Leben ändern«.
Rüdiger Dannemann ist Philosophielehrer und Vorsitzender der Internationalen Georg-Lukács-Gesellschaft.