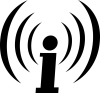Für Spanien haben entscheidende Wochen begonnen. Mit einem radikalen Sparprogramm will Ministerpräsident Rajoy den Weg für neue ESM-Hilfen frei machen. Doch die Regierung geht damit ein doppeltes Risiko ein. Sie verschärft die Rezession und bringt die eigene Bevölkerung gegen sich auf.
Hamburg - Am Vorabend des großen Tages gab sich Mariano Rajoy entschlossen: "Wir wissen, was wir tun müssen, und da wir es wissen, tun wir es", kündigte der spanische Ministerpräsident am Mittwochabend in New York an.
Zurück in der Heimat lief es dann doch nicht ganz so rund. Immer wieder verzögerte sich am Donnerstag die Vorstellung des neuen Reformprogramms, mit dem die Regierung die internationalen Geldgeber überzeugen will. Am Abend war endlich klar: Die viertgrößte Wirtschaft der Euro-Zone wird ihren schon 2011 eingeschlagenen Sparkurs noch einmal drastisch verschärfen.
Der Etat werde im kommenden Jahr um 40 Milliarden Euro entlastet, sagte Finanzminister Cristobal Montoro in Madrid. Die einzelnen Ministerien müssen demnach im Durchschnitt 8,9 Prozent einsparen. "Das ist ein Haushalt in Zeiten der Krise, aber einer, mit dem wir aus der Krise rauskommen", sagte Vizepräsidentin Soraya Saenz de Santamaria.
Regierungschef Rajoy steckt in einem Dilemma: Einerseits muss er sparen, will er die mit der EU vereinbarten Defizitziele auch nur annähernd erreichen - andererseits riskiert er durch allzu harte Kürzungen einen Volksaufstand, der das Land in eine tiefe politische Krise stürzen könnte.
Bereits jetzt herrscht großer Unmut im Land. Die Gewerkschaften haben einen "heißen Herbst" angekündigt. Am Dienstag und Mittwoch demonstrierten zigtausende Menschen vor dem spanischen Parlament in Madrid. Immer wieder gibt es Verletzte, wenn Polizei und Demonstranten aufeinandertreffen.
In der Region Katalonien flammen zudem separatistische Forderungen auf: Der katalanische Regierungschef Artur Mas hat für Ende November Neuwahlen angesetzt. Nun will er die Bevölkerung auch noch über die Unabhängigkeit der Region abstimmen lassen - zur Not auch gegen ein Veto aus Madrid. Katalonien ist hoch verschuldet, aber wirtschaftsstark. Regierungschef Mas will deshalb einen größeren Teil der Steuereinnahmen in der Region behalten, anstatt das Geld in ärmere Provinzen zu leiten.
Die politischen Unruhen sind ein Zeichen dafür, dass die Krise in Spanien an einem entscheidenden Punkt angelangt ist. Das Land steckt seit Ende 2011 in der Rezession, jeder vierte Spanier ist arbeitslos, bei den Jugendlichen sogar mehr als jeder zweite. Im vergangenen Jahr hat die Regierung bereits im Bildungs- und Gesundheitswesen gekürzt sowie wichtige Steuern erhöht. Wenn nun noch mehr gespart wird, so fürchten viele Menschen, wird die Krise nur noch schlimmer.
Viele Experten sehen das ähnlich: "Das ist der falsche Zeitpunkt für neue Sparprogramme", sagt Peter Bofinger, Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung. So werde sich die Krise nicht lösen lassen. Griechenland ist für ihn das beste Beispiel für das Scheitern einer solchen Strategie. "Niemand hat so viel gespart wie Griechenland - und am Ende hat sich das Land kaputt gespart. Es besteht die Gefahr, dass Spanien irgendwann in die gleiche Situation kommt."
Die Haushaltsziele sind kaum zu erreichen
Andererseits muss Spanien sparen, wenn es an frisches Geld kommen will. Nicht nur die Investoren an den Finanzmärkten achten darauf, dass die Regierung das Staatsdefizit in den Griff bekommt, auch die Partner in der Euro-Zone und die Europäische Zentralbank (EZB) machen mögliche Hilfen für Spanien von der Einhaltung der Sparziele abhängig.
Und die sind hoch gesteckt. Die spanische Regierung hatte sich bei der EU-Kommission dazu verpflichtet, das Defizit des Zentralstaats in diesem Jahr auf 2012 auf 4,5 Prozent der Wirtschaftsleistung herunterzufahren. Nimmt man die Regionen, die Kommunen und die Rentenversicherung hinzu, soll das Minus höchsten 6,3 Prozent betragen - nach 8,9 Prozent 2011.
Die meisten Ökonomen glauben nicht, dass Spanien diese Ziele erreichen kann. Schließlich hatte der Zentralstaat die 4,5-Prozent-Grenze schon nach den ersten acht Monaten des Jahres überschritten. Um es doch noch zu schaffen, müsste die Regierung zum Jahresende Überschüsse erwirtschaften. Die neuen Reformen sollen das Unmögliche nun doch noch möglich machen - oder zumindest den guten Willen der Politik dokumentieren.
Das dürfte die Grundvoraussetzung dafür sein, dass die Europäische Zentralbank spanische Staatsanleihen am Markt aufkauft - und damit die Zinslast verringert, die Spanien immer stärker zu schaffen macht. Nach Informationen der Zeitung "El País" wird der spanische Staat 2013 voraussichtlich 38 Milliarden Euro allein für seinen Schuldendienst aufwenden.
Durch die Anleihenkäufe der EZB soll diese Belastung sinken. Die Zentralbank hatte sich Anfang September dazu bereiterklärt, betroffenen Ländern zu helfen - allerdings müsse die jeweilige Regierung zuerst einen Hilfsantrag bei europäischen Rettungsfonds ESM stellen. Und der wiederum verlangt die Einhaltung von Sparbeschlüssen.
"Spanien hofft, dass dieses Sparpaket ausreicht, um Hilfen aus dem ESM und damit von der EZB zu bekommen, falls das nötig wird", sagt Holger Schmieding, Chefökonom der Berenberg Bank. Die Regierung in Madrid wird nach seiner Einschätzung alles tun, um die Lage des Landes zu verbessern, allerdings solle es nicht so aussehen, als beuge man sich dem Druck von außen.
Streit um die Bankenhilfen
Um den Staatshaushalt zu schonen, will die Regierung ihr größtes Problem am liebsten direkt von den europäischen Partnern lösen lassen: Viele Banken des Landes haben sich mit Immobilienkrediten übernommen und brauchen dringend frisches Kapital. An diesem Freitag sollen die Ergebnisse eines sogenannten Stresstests vorgelegt werden. Die Unternehmensberatung Oliver Wyman hat im Auftrag von Wirtschaftsministerium und Zentralbank geprüft, welche Institute wie viel Hilfe benötigen. Schätzungen zufolge soll der Bedarf bei rund 60 Milliarden Euro liegen.
Die Summe zu bekommen, ist eigentlich kein Problem: Die Euro-Partner hatten Spanien bereits bis zu 100 Milliarden Euro aus dem Rettungsfonds ESM zugesagt. Allerdings soll das Geld zunächst als Kredit an den Staat fließen, der es anschließend in die Banken investiert. Das hilft den Spaniern nur bedingt, weil so die Staatsschulden weiter steigen und damit die Zinsen, die Spanien zahlen muss.
Die Regierung in Madrid spekuliert deshalb darauf, das Geld aus dem ESM in direkte Hilfen für die Banken umzuwandeln. Als Grundlage dafür sieht sie einen Beschluss der Euro-Staaten beim Krisengipfel Ende Juni. Spät in der Nach hatten sich damals die Staats- und Regierungschefs darauf geeinigt, eine einheitliche Bankenaufsicht in der Euro-Zone zu schaffen. Wenn diese errichtet sei, könnten künftig marode Banken auch direkt aus dem ESM Kapitalspritzen erhalten.
Mittlerweile ist ein Streit darüber entbrannt, wie der Beschluss vom Juni zu interpretieren sei. Spanien aber auch andere Südländer und die EU-Kommission pochen darauf, dass alle Bankenhilfen direkt aus dem ESM fließen können, sobald eine europäische Bankenaufsicht geschaffen wurde - also vielleicht schon Anfang kommenden Jahres.
Zudem heißt es in der Erklärung der Nordländer, bevor der ESM angezapft werden könne, sollten zunächst privates Kapital und nationale Steuergelder genutzt werden. Dieser Punkt könnte in Zukunft noch für Streit sorgen, meint Clemens Fuest, Wirtschaftsprofessor in Oxford und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesfinanzministerium: "Die spanische Regierung würde gerne massiv Staatsgeld einsetzen, um die Banken zu retten, Deutschland und andere Staaten dringen dagegen darauf, dass zuerst die Aktionäre und Gläubiger der Banken einspringen."
Für Fuest ist es "extrem wichtig, dass die privaten Gläubiger der Banken so weit wie möglich beteiligt werden - zum Beispiel durch Umwandlung von Anleihen in Aktien". Ansonsten würden alle Kosten nur auf die Steuerzahler abgeladen. "Das wäre fatal", meint Fuest, "in ganz Europa müssten dann die Steuern steigen."