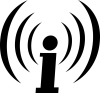Das Dauerfeuer der syrischen Armee, die verwüstete Stadt, traumatisierte Familien: Marie Colvin dokumentierte das unermessliche Leid der Menschen in Homs - bis sie selbst tödlich von einer Granate getroffen wurde. Lesen Sie ihre letzte Reportage für die "Sunday Times".
Sie nennen es den Keller der Witwen. Zwischen provisorischen Betten und allem möglichen Hab und Gut drängen sich verängstigte Frauen und Kinder. Sie sind Gefangene des Horrors von Homs. Seit zwei Wochen wird die syrische Stadt unablässig bombardiert.
Unter den dreihundert Menschen, die sich in den Keller einer Fabrik im Stadtteil Baba Amr geflüchtet haben, ist auch die 20-jährige Noor, die ihren Mann im Geschosshagel verloren hat. "Unser Haus wurde von einer Rakete getroffen", erzählt sie. "Danach lebten 17 von uns in einem Zimmer." Mimi, ihre dreijährige Tochter und Mohamed, ihr fünfjähriger Sohn, klammern sich an ihre Abaja.
"Zwei Tage haben wir außer Zucker und Wasser nichts mehr zu essen gehabt, und dann ist mein Mann losgegangen, um Lebensmittel zu finden." Das war das letzte Mal, dass sie Masiad, der in einer Werkstatt für Handys arbeitete, gesehen hat. "Er wurde von einer Granate in Stücke gerissen." Für Noor war es ein doppelter Schicksalsschlag, denn ihr 27-jähriger Bruder Adnan wurde zusammen mit Masiad getötet.
Jede Frau im Keller hat solche Geschichten von Not und Tod zu erzählen. Sie haben sich in dieses Loch geflüchtet, weil es einer der letzten unversehrten Keller in Baba Amr ist. Tagsüber schieben sie die Schaumstoffmatratzen an die Wände ihres Unterschlupfs; die Kinder haben seit Beginn der Belagerung durch die Regierungstruppen am 4. Februar das Tageslicht nicht mehr gesehen. Die meisten Familien hatten keine Zeit mehr zu packen. Was sie noch besitzen, tragen sie am Körper.
Dem Bombeneinschlag wie durch ein Wunder entkommen
Die Lebensmittel sind knapp geworden in der Stadt, Reis haben sie noch und Tee - und ein paar Dosen mit Thunfisch, die einer der Clanführer aus einem ausgebombten Supermarkt mitgebracht hat.
Letzte Woche ist im Keller ein Baby zur Welt gekommen, es wirkt genauso verstört wie seine Mutter. Fatima, 19 Jahre alt, kam in den Keller, als ihr Wohnhaus dem Erdboden gleichgemacht worden war. "Wir sind dem Bombeneinschlag wie durch ein Wunder entkommen", flüstert sie. Sie ist schwer traumatisiert und kann ihrem Säugling nicht die Brust geben. Das Baby bekommt Zucker und Wasser, Milchpulver gibt es hier nicht.
Fatima weiß noch nicht, ob sie Witwe ist oder nicht. Ihr Mann arbeitet als Viehhirte und war draußen auf dem Land, als der Beschuss der Stadt begann. Aber sie hat seither nichts von ihm gehört.
Der Keller der Witwen ist wie ein Sinnbild für die Lage der 28.000 Männer, Frauen und Kinder in Baba Amr. Der Stadtteil besteht vor allem aus Einfamilienhäusern, die aus einfachen Hohlblocksteinen hochgezogen sind. Die Siedlung ist auf allen Seiten von der syrischen Armee umzingelt. Das Militär feuert wahllos mit Raketenwerfern, Mörsern und Panzerkanonen auf das Wohngebiet.
Scharfschützen auf den Häusern, rennende Menschen
Auf den Dächern der benachbarten Baath-Universität und von den höheren Gebäuden, die Baba Amr umgeben, liegen Scharfschützen, die auf jeden Zivilisten feuern, den sie ins Visier bekommen. In den ersten Tagen der Belagerung sind die Bewohner des Viertels gleich reihenweise umgemäht worden. Inzwischen wissen sie, wo Scharfschützen lauern. Wenn sie aus der Deckung über eine Kreuzung müssen, rennen sie, so schnell sie können. Autos sind auf den Straßen kaum noch zu sehen.
In fast jedem Gebäude klaffen Krater; Raketen und die Geschosse der Panzerkanonen haben Löcher in Fassaden und Zwischendecken gerissen. Das Haus, in dem ich untergebracht war, verlor in der vergangenen Nacht das komplette obere Stockwerk. In manchen Straßen sind ganze Gebäude eingestürzt. Übrig bleiben die zerfetzten Kleidungsstücke der Bewohner, ihr zerborstenes Mobiliar, zerbrochene Teller, Tassen und Töpfe.
Baba Amr ist ein Viertel der Hungrigen und Frierenden, das widerhallt vom Krachen der explodierenden Raketen und von den Salven der Gewehre. Es gibt kein Telefon mehr in der Stadt, und auch die Stromleitungen sind längst gekappt. Nur wenige Familien haben Diesel, um mit ihren Öfen gegen die Kälte anzuheizen. An einen Winter wie diesen kann sich niemand erinnern.
Brotwurf über die Dächer von Homs
Die Pfützen in den Schlaglöchern werden zu Eis, und Schnee weht durch zerschossene Fenster. Geschäfte sind geschlossen oder zerstört, die Familien teilen das wenige, das sie haben, mit ihren Nachbarn. Viele der Toten und Verletzten gerieten bei der Suche nach Lebensmitteln ins Feuer der Armee. Aus Angst vor den Scharfschützen werfen sich Menschen das Brot über die Dächer zu - oder sie durchbrechen sogar die Wände zwischen den Häusern, um sich unentdeckt Lebensmittel zu reichen.
Die regulären syrischen Truppen haben einen Graben ausgehoben, der fast um die gesamte Stadt läuft. Sie lassen kaum noch jemanden rein nach Baba Amr oder raus aus der Stadt. Die Armee setzt ihr Vorhaben gnadenlos um, den Widerstand gegen das Regime in Homs, Hama und den anderen Städten zu brechen.
In Baba Amr steht die Zivilbevölkerung geschlossen hinter der Freien Syrischen Armee (FSA), dem bewaffneten Arm der Opposition gegen Assad. Aber es ist ein ungleicher Kampf: Die Rebellen haben Kalaschnikows, die Armee fährt Panzer und schwere Geschütze auf. Etwa 5000 Soldaten hat die Regierung rund um Baba Amr zusammengezogen. Es heißt, sie würden einen Angriff am Boden vorbereiten.
"Es wird ein Massaker geben"
"Wir haben große Angst, dass die FSA aus der Stadt abzieht", sagt Hamida. Die 43-Jährige versteckt sich mit ihren Kindern in einer verlassenen Erdgeschosswohnung, ihr Haus wurde von Bomben zerstört. Sie fürchtet: "Es wird ein Massaker geben."
Was jeder denkt und kaum jemand ausspricht, ist die Frage: "Warum lässt uns die Welt im Stich?"
Die Bilanz von Uno-Generalsekretär Ban Ki Moon sah vergangene Woche so aus: "Wir sehen, wie wahllos Wohngebiete beschossen werden, dass in Krankenhäusern gefoltert wird, dass Kinder, die vielleicht zehn Jahre alt sind, getötet oder missbraucht werden. Was wir hier beobachten, sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit." Doch die internationale Gemeinschaft konnte sich nicht dazu durchringen, diesen unschuldigen Opfern zur Hilfe zu kommen.
Der 20-jährige Abd al-Madschid hat dabei geholfen, Verwundete aus einem zerschossenen Gebäude zu retten. Seine Bitte an mich ist ganz simpel: "Sag der Welt, dass sie uns helfen muss", sagt er zitternd. "Hauptsache, das Bombardement hört auf. Sag ihnen bitte, dass sie aufhören zu schießen!"
Die rote Bluse in den Trümmern
Als die Zeiten noch besser waren, verlief die Straße vom Libanon nach Homs durch ärmliche, aber idyllische Dörfer. Unbefestigte Alleen, von Zypressen und Pappeln gesäumt, führten zu bescheidenen, einfachen Häusern und ihren Obstgärten.
Heute liegt Angst über der Idylle, das spürt jeder, der diesen Weg nimmt. Dabei ist dieser Landstrich zum größten Teil "freies Syrien", das von der FSA kontrolliert wird. Trotzdem hält Assads Armee die wichtigsten Kreuzungen, seine Truppen sind in Schulen stationiert, in den Krankenhäusern, Fabriken. Die Soldaten sind schwer bewaffnet, sie haben die Feuerkraft von Panzern und Artillerie in der Hinterhand.
Wer nach Homs will, muss sich also auf den Wegen durch die Felder durchschütteln lassen. Gelegentlich kommt man an einem Checkpoint der FSA vorbei. Die Männer wärmen sich an einem Lagerfeuer und schauen sich jeden Wagen, der passieren will, ganz genau an. Im Dunklen ist die Reise noch gespenstischer, dann sind nur noch die Strahlen von Taschenlampen zu sehen, die von unsichtbaren Figuren geschwenkt werden. Sie geben ein Zeichen, die Strecke ist frei, weiter!
Die Bauern kennen alle Schleichwege
In jedem Auto, das FSA-Land durchquert, fährt ein Hirte oder Bauer mit, der sich mit den Gegebenheiten vor Ort auskennt. Die syrische Armee hat zwar noch die Macht im Land, aber nur die Leute vor Ort kennen die Nebenstrecken und Schleichwege.
Auch ich bin auf der Route der Schmuggler nach Homs gekommen. Ich musste vorher versprechen, dass ich nicht verraten würde, wie ich in die Stadt gelangte. Zum Schluss ging es durch schlammige Gräben und über Mauern. Als ich Homs in den frühen Morgenstunden erreichte, erwartete mich schon ein regelrechtes Empfangskomitee, das große Hoffnungen auf ausländische Journalisten setzte.
Endlich würde jemand der Welt vom Schicksal ihrer Stadt berichten. Alle kletterten auf die offene Ladefläche eines Lieferwagens, und der Fahrer raste mit eingeschaltetem Fernlicht los. "Allahu akbar!", brüllten sie hinten. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis die syrischen Soldaten das Feuer auf uns eröffneten.
Später stieg ich in einen kleineren Wagen um, jetzt ohne auffälliges Scheinwerferlicht. Es ging dunkle, leere Straße entlang, die Gefahr war förmlich zu spüren. Auf einem offenen Stück Straße feuerte die syrische Armee mit Maschinengewehren und Granaten auf uns. Wir suchten hinter verlassenen Gebäuden Schutz.
Das Ausmaß der menschlichen Tragödie ist gewaltig. Abu Ammar, 48-jähriger Taxifahrer, berichtet, wie er in der vergangenen Woche sein Haus verlassen hat, um nach etwas zu Essen zu suchen. Zusammen mit seiner Frau und der Adoptivtochter hatte er bei zwei älteren Schwestern Unterschlupf gefunden.
Nur eine rote Bluse in den Trümmern
"Als ich zurück kam, war von dem Haus nichts mehr übrig", sagte Ammar. Nur einige Reste Mauerwerk standen noch - im Schutt der Ruine leuchtete eine rote Frauenbluse. Einige Gläser mit eingemachtem Gemüse hatten die Katastrophe überstanden, irgendwie. "Dr. Ali" - eigentlich Zahnarzt, jetzt Chirurg - sagte, eine der Frauen sei noch lebend in die Klinik gebracht worden. Später musste man ihr beide Beine amputieren und sie starb.
Die Klinik ist in Wirklichkeit nur eine Wohnung im ersten Geschoss, die der Besitzer freundlicherweise zur Verfügung stellt. Vieles wirkt deplatziert, wie aus einer anderen Welt. Infusionsbeutel hängen an Kleiderbügeln aus Holz, und über den Köpfen der Patienten drehen sich die Mobiles der Kinder, die hier einmal lebten.
Das Bombardement vom Freitag was das bisher schwerste überhaupt. Immer mehr Verwundete kamen in der Klinik an, von Verwandten gefahren, auf der Rückbank ihrer Autos. Ali der Zahnarzt schnitt dem 24-jährigen Ahmed al-Irini auf einem der zwei OP-Tische der Klinik die Kleidung vom Leib. Granatsplitter hatten seinen Oberschenkel in blutige Fetzen gerissen. Auch unterhalb seines linken Auges steckte ein Metallsplitter.
Seine Beine zuckten noch einmal, als al-Irini auf dem OP-Tisch starb. Sein Schwager, der ihn in die Klinik gefahren hatte, brach in Tränen aus. "Wir haben Karten gespielt, als die Rakete unser Haus traf", schluchzte er. Irini wurde in die provisorische Leichenhalle gebracht, ein Schlafzimmer weiter hinten in der Wohnung. Er wurde nackt aufgebahrt, eine Plastiktüte bedeckte seine Genitalien.
"Ich muss das hier aushalten. Ich muss"
Und so ging es weiter. Chaled Abu Kamali starb, bevor der Arzt auch nur seine Kleidung entfernen konnte. Er wurde in seinem Haus von einem Granatsplitter in der Brust getroffen.
Salah, 26 Jahre alt, war gleich von mehreren Granatsplittern getroffen worden, im Brustkorb und im Rücken. Eine Betäubung bekam er nicht, aber er konnte sogar noch sprechen, als Ali eine Metallröhre in Salahs Rücken einführte, um Blut aus seinem Brustkorb abzulassen.
Um die anderen Verwundeten kümmerte sich Um Ammar, eine 45-jährige Mutter von sieben Kindern, die sich freiwillig als Krankenschwester gemeldet hatte, nachdem das Haus ihrer Nachbarn getroffen worden war. Sie trug schmutzige Latexhandschuhe und weinte. "Ich muss das hier aushalten. Ich muss. Die Kinder, die hier eingeliefert werden, sie sind alle meine Kinder", sagte sie. "Aber es ist so schwer."
Achmed Mohammed war Militärarzt in der Armee Assads - bis er desertierte. Jetzt ruft er in den Raum: "Was ist denn eigentlich mit den Menschenrechten. Haben wir etwa keine? Wo sind denn eigentlich die Vereinten Nationen?"
Auszüge aus der letzten Reportage von Marie Colvin, erschienen am 19. Februar 2012 in der The Sunday Times