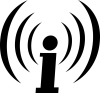Plötzlich knickte mein Fuß weg. Kurz vor der Geburt meines Sohnes war ich über den Sportplatz gelaufen und dabei ungünstig aufgekommen. Mein Fußgelenk schmerzte, nicht viel, nur beim Auftreten tat es weh. Ich wurde wütend. "Man, jetzt kannst du dein eigenes Kind nicht mehr beschützen!", dachte ich. "Das kann doch nicht wahr sein, dass du nicht auf dich aufpassen kannst! Wie konnte dir das passieren!" Nach der Wut kam die Panik: Aufpassen war das Wichtigste, was ich in meiner Kindheit und Jugend gelernt hatte.
Im Jahr 1992 bin ich sieben Jahre alt und starre auf den Fernsehbildschirm. Es zeigt ein Hochhaus in Flammen. Ich verstehe nicht. Ich ahne nur, dass es eine ernste Situation sein muss. Meine Eltern sind ganz still. "Jetzt wollen sie uns umbringen!", stottert mein Vater schließlich. Dem Tod, dachten sie, waren sie eigentlich schon entflohen: In den siebziger Jahren waren sie vor dem Vietnamkrieg in einem winzigen Fischerboot auf das offene Meer geflüchtet. Nach einer langen Odyssee waren sie letztlich nach Deutschland gekommen, in einen kleinen Ort in der Eifel. Von dort aus sehen sie nun zu, wie Hunderte Neonazis und Tausende Anwohner in Rostock-Lichtenhagen eine Erstaufnahmestelle für Asylbewerber und einen Wohnblock vietnamesischer Vertragsarbeiter belagern. Brandsätze fliegen auf das Sonnenblumenhaus und auf dem Höhepunkt des Pogroms zieht sich die Polizei teilweise vollständig zurück.
Mit Metallknüppeln gegen Nazis
Nach den Nachrichten sagt mein Vater, er müsse mir im Esszimmer etwas beibringen. Er fragt mich, ob ich ihm vertrauen würde. Ich bejahe und wir gehen rüber. Dort packt er mich. Ich müsse mich befreien, ruft er. "Ich kann nicht!", rufe ich zurück. Ich strample, aber ich habe keine Chance gegen seine Kraft. Mein Vater schreit mir ins Gesicht: "Ich bin noch lieb zu dir, aber der Nazi wird dich umbringen!" Ich schreie nun auch, sage, dass er mich loslassen soll. Entgeistert kommt meine Mutter dazu und fordert, dass er den Griff lösen soll. "Wir müssen ihm aber beibringen, stark zu sein!", entgegnet mein Vater. "Insbesondere, wenn sie kommen! Wenn wir zu sanft zu ihm sind, wird er sich nie verteidigen können!", sagt er. "Wir sind aber nicht mehr im Krieg!", erwidert meine Mutter aufgebracht. "Der Krieg ist vorbei! Hör auf!" Widerwillig lässt er los.
In den nächsten Tagen kommt mein Vater mit Starkstromleitungen nach Hause. Sie waren in kurze Stücke geschnitten. "Guck einmal! Die sind wie richtige Knüppel mit Metallkern!", sagt er und zeigt sie stolz meinen zwei älteren Geschwistern und mir. "Wenn Leute uns jetzt angreifen oder ausrauben wollen, dann können wir uns verteidigen!" Noch an demselben Abend bringt er uns bei, wie wir die Knüppel im Ernstfall anwenden sollen.
Eier und Hundescheiße
Noch in derselben Nacht weckt uns lautes Hupen. "Deutschland den Deutschen!", grölen ein paar Männer draußen. "Ausländer raus!" Ich renne ins Wohnzimmer, dort stehen meine Eltern wie versteinert am Fenster. Mein Vater hat einen der neuen Knüppel in der Hand. Ich bin zu erschrocken, um meinen eigenen Knüppel zu holen. "Was soll ich machen?", frage ich. Sie antworten nicht. Ich frage noch einmal, wieder antworten meine Eltern nicht. Nach gefühlt stundenlangen Minuten ziehen die Männer wieder fort. Ich stehe im Wohnzimmer und wünsche mir, mich nie mehr schwach fühlen zu müssen.
Es sollte nicht der einzige nächtliche Übergriff bleiben. An manchen Morgen klebten Eier an unserer Hauswand oder Hundescheiße. Unbekannte hatten sie dorthin hingeschmiert. Meine Eltern säuberten die Wand am nächsten Tag wieder. Auch Steine schmissen die Leute. Auf jeden Knall folgten Gelächter und schnelle, leiser werdende Schritte. Manchmal versuchte ich aus Wut hinterherzulaufen, aber ich war zu langsam.
Im Jahr 1998 bin ich 13 Jahre alt und stehe auf dem Schulhof. Fünf Mitschüler, alle wesentlich größer als ich, umzingeln mich. "Wo haste denn deine Jeans geholt?", fragt einer. Ich verstehe die Frage nicht. "Bei C&A!", antworte ich. "Nene, beim Viet Cong, Japse! Da kauft ihr doch alle ein, ihr Scheißjapsen! Hört ma’ her Leute, der Japse hat Jeans vom Viet Cong!" Dann laufen sie auf mich zu. Einer erwischt mich am Arm, aber ich kann mich losreißen. Ich laufe so schnell ich kann weg, aber ich stolpere und meine Jeans zerreißt. Ein Junge setzt sich auf meinen Rücken und hält mich fest. "Jetzt bin ich tot!", denke ich. "Gleich werden sie mich zu Tode prügeln." Dann kommt die Pausenaufsicht und die Jungs rennen weg.
"Rassismus gibt es in Deutschland nicht mehr"
Am nächsten Tag sitze ich mit meinen Eltern beim Klassenlehrer. Er sagt, dass er mit allen geredet habe und dass es allen leid tue. "Es sind halt Jungs, die sich ausprobieren müssen. Das ist ganz normal in diesem Alter", sagt er. "Das ist Rassismus", sagen meine Eltern. Das Wort kannten sie gut, sie sahen ja die Nachrichten. Mein Lehrer sieht das anders: "Rassismus! Rassismus gibt es in Deutschland nicht mehr. Das war ein Problem von früher. Ich verstehe ja, dass Sie nicht aus Deutschland kommen und das daher nicht verstehen können. Aber das, was passiert ist, das hat nichts mit Rassismus zu tun."
Im Auto wiederholt mein Vater seine Forderung, ich müsse mich besser verteidigen lernen: "Wenn die anderen größer sind als du, dann musst du schneller sein." Diesmal pflichtet ihm auch meine Mutter bei.
Zorn und Gewaltfantasien
Von da an trainiere ich. Ich spiele Volleyball und gehe regelmäßig Joggen. War ich damals noch der Langsamste in der Klasse, wurde ich immer schneller. "Du musst verstehen, dass dich in Deutschland niemand verteidigen wird!", höre ich meine Eltern oft sagen. Jetzt könnten sie mich noch beschützen, "aber wenn wir nicht da sind, dann musst du es selber können". Außerdem, sagen sie, müsse ich klug sein, denn die anderen seien größer als ich. "Das heißt, sie werden immer stärker sein als du. Wenn sie stärker sind, dann musst du schneller und klüger sein als sie." In mindestens einer Sache hatten meine Eltern recht: Beschützt hat man mich nicht. Und zu häufig war ich nicht schneller oder klüger als meine Angreifer.
Meine Rettung: das Theater
Im Jahr 2002 bin ich 17 Jahre alt und möchte nur noch weg. Weg aus der Eifel, weg aus dieser kleinen, westdeutschen Provinz, weg von den Menschen dort. Aber ich muss noch ein Jahr zur Schule gehen und vielleicht einen Zivildienst ableisten. In der Öffentlichkeit lächele ich, um nicht negativ aufzufallen. Innerlich könnte ich vor Zorn zerbersten. Lehrer glauben mir nicht, dass ich angegriffen werde, und meine Mitschüler empfinde ich mehr als Feinde denn als Freunde. Ich fantasiere, wie ich mit einer Waffe durch meine Schule renne und jeden erschieße. Jeder sollte meine Wut zu spüren bekommen und keiner würde entkommen.
Stattdessen sitze ich im Geschichtsunterricht und meine Lehrerin sagt, dass im Nachbarort eine neue Theatergruppe entstanden sei. "Theater!", denke ich. Theater ist zwar nicht wirklich das, was mich interessiert, aber es könnte mich bis zu meinem Wegzug ablenken. Wenig später halte ich einen Flyer in meiner Hand und melde mich zum Amateurtheater an. Ich lerne fechten und Bühnenkampf, lese antike Dramen und spiele Schurken, Wahnsinnige und Clowns.
Die Entscheidung zum Theater hat mich vermutlich vor meinem eigenen Untergang gerettet. Sie rettete mich vor meiner eigenen Wut und dem Hass anderer. "Ohne die Kunst hätte ich meine Kindheit und Jugend nicht emotional überlebt", zitierte mich letztens eine Moderatorin auf einer Podiumsveranstaltung. Dann erzählt ein vietnamesischer Gast aus dem Publikum, er habe von klein auf lernen müssen, schnell zu sein – um zu überleben. Er musste entweder rennen oder schneller zuschlagen, um sich gegen Rechte zu verteidigen. Ich sagte ihm, dass es mir genauso ging und lachte innerlich, weil wir dasselbe durchgemacht hatten.
Jetzt ist genau ein Jahr vergangen, seitdem mein Fuß umgeknickt war. Er ist geheilt. Mein Sohn übt gerade seine ersten Schritte und ich kann nicht aufhören, ihm dabei zuzusehen. Ich hoffe, dass ich immer genügend Stärke finden werde, ihn zu beschützen, sollte er angegriffen werden. Ich will ihm beibringen, wachsam zu sein und für sich einstehen zu können. Ich will ihm aber nicht beibringen, sich mit Knüppeln zu verteidigen – obwohl mich manchmal Angst überkommt bei den Nachrichten über Anschläge gegen Flüchtlingsheime und dem Erstarken rechter Parteien. Der nächsten Generation sollten wir andere Mittel zur Verteidigung geben: mehr Rechtsstaat, mehr zivilgesellschaftliches Engagement. Nur so kann die tiefe Angst in meiner Generation gelöst werden.