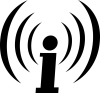Autos brennen, Farbbeutel fliegen, ein Bezirk verändert sich: Warum der Kampf gegen die Gentrifizierung jetzt im Schillerkiez eskaliert
Früher war es hier nachts totenstill, nur manchmal fielen Schüsse. Heute klirrt stattdessen Glas, Stimmen aus aller Welt hallen durch die Straßen, ein DJ spielt zur Eröffnung einer Bar nah am Flugfeld Tempelhof. Einer ziemlich hippen Bar, wo die Möbel Second Hand und die Wände ohne Tapete sind. Die sich zu den vielen Bars gesellt, die hier im Schillerkiez bereits existieren. Gleich ums Eck gibt es sogar eine Art Diskothek in einem Wohnhaus. Die Gäste sind jung und modisch gekleidet. Vor der Tür sitzt ein Mädchen zwischen zwei Autos auf dem Bordstein und schnieft weißes Pulver von ihrem Handydisplay.
Im Laufe der Nacht werden zwei Gäste in die Baumscheibe urinieren und einer in den Eingang des Hauses nebenan. Es ist der Discount-Tourismus, für den Berlin so legendär ist: eine Runde geil und günstig feiern gehen. Das Re-Enact ment eines Mythos, der entstand, als die Mieten noch niedrig und die Brachen viele waren. Die Feiernden sind im Kiez nicht sonderlich beliebt. „Wir laufen hier alle mit geballter Faust in der Tasche rum“, erzählt Christian, er lebt seit 30 Jahren am Herrfurthplatz. Ein anderer Anwohner sagt: „Ich habe gar keinen Bock mehr, auf die Straße zu gehen, ich fühle mich da eingekesselt.“
Die Stadt ist zu voll. Sie ist nicht mehr die gleiche und wird sie nie wieder werden. Die Mieten sind im Schnitt in den letzten zwei Jahren um fast zehn Prozent gestiegen. Immer mehr Altmieter verzweifeln – oder sie wehren sich. Mit Spucke, Farbe, Grillanzündern. Die Wahl der Mittel könnte weiter eskalieren. Täglich werden in Berlin rund 15 Menschen, vielleicht sogar noch mehr, mit Polizeigewalt aus ihren Wohnungen geholt und auf die Straße gesetzt. Berlin ist zu einer internationalen Metropole geworden. Mit entsprechenden Preisen und Platzverhältnissen. Da leben, wo andere Urlaub machen: Es ist das Zootier-Phänomen. Die Beliebtheit der Metropole ist zu ihrem größten Problem geworden. Das, was Berlin so besonders machte: Der viele freie Raum, in dem man für wenig oder kein Geld seine Kreativität verwirklichen konnte, ist Geschichte. Und der wenige, der noch bleibt, ist heiß umkämpft.
Rund um die Rigaer Straße in Friedrichshain ist der Widerstand gegen die Gentrifizierung längst militant. Dann gab es einen Farbangriff auf ein Restaurant in der Reichenberger Straße in Kreuzberg. Und nun beginnt es in Neukölln: zwei Angriffe von mutmaßlichen Gentrifizierungsgegnern in den vergangenen Wochen. Im Schillerkiez wurden vor einer jungen Burger-Braterei, die auch vegane und vegetarische Varianten anbietet, zwei Lieferwagen der Firma angezündet. Im Weserkiez wurde fast gleichzeitig ein neu eröffnetes 33-Betten-Hostel das Ziel von Farbattacken. Die Angriffe richten sich nicht gegen Vermieter und Investoren, sondern gegen Mieter. Gegen Nachbarn. Die Ärmsten bekriegen die, die gerade dabei sind, sich hochzuarbeiten – so sieht es aus.
Bei dem Feuer vorm Schillerburger brannten auch zwei andere Autos mit ab. Am Morgen danach war die Straße mit gut 20 Zentimetern Löschschaum bedeckt. Es sah aus, als hätte es geschneit. Einen Monat später stehen die Wagen immer noch dort. Sie sind ein Symbol. Touristen machen vor den Wracks Selfies. Verbrannte Autos stehen für das alte, ein bisschen räudige, widerspenstige Berlin, das die Touristen gerne sehen wollen.
Schillerburger hingegen steht eher für den Wandel und die Kommerzialisierung der Nachbarschaft. Der Burgerbrater startete 2012 mit einem Laden, inzwischen hat er Filialen in acht Bezirken, drei weitere Läden sind in Planung, dazu macht er viel Umsatz über Bestellportale. Auf der Website steht: „Der Erfolg war von Beginn an enorm.“ 2015 wurde die CMGZ Burger Berlin GmbH an die Heristo-Aktiengesellschaft verkauft, eines der größten deutschen Nahrungsmittelunternehmen und in Europa einer der größten Hersteller von Heimtiernahrung. Vor Jahren wurde Schillerburger auch einmal mit Farbbeuteln beworfen, es gab ein Bekennerschreiben. Dieses Mal gab es keines, obwohl die öffentliche Erklärung unter Linksradikalen fast selbstverständlich ist.
Katrin Schmidberger, grüne wohnungspolitische Sprecherin im Abgeordnetenhaus sagt: „Ich kann verstehen, dass man so verzweifelt ist, dass man so etwas tut, aber es gibt AfD und CDU nur Futter. Dann sprechen die wieder über Linksradikale statt über das Mietenproblem.“ Schmidberger ist neuerdings Mitglied der Regierungskoalition. Viele Möglichkeiten, etwas zu ändern, habe sie trotzdem nicht. „Berlin muss ausbaden, dass die große Koalition im Bund die Mieter seit Jahren im Stich lässt.“
Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher, Linke, die sich wählen ließ, um den Mietenwahnsinn unter Kontrolle zu bekommen, sagt inzwischen: „Als Stadt haben wir nicht alle Möglichkeiten der Welt. Um Neubau-Mieten zu deckeln oder Grunderwerb von Kapitalgesellschaften zu limitieren, wären Änderungen auf Bundesebene notwendig. Was wir tun können, ist, mit unseren eigenen Wohnungsbaugesellschaften dafür zu sorgen, dass die Verteilung von Wohnraum für Menschen mit wenig Geld in der Stadt gleichmäßig bleibt.“
Gerhard von der ehemaligen Stadtteilinitiative Schillerkiez, die sich um die Entwicklung des Areals rund um die Schillerpromenade sorgte, wohnt in der Weisestraße. Er sagt: „Mir stellt sich die Frage, wie lange ich noch hier bleiben kann. Ich hab sehr wenig Geld, ich bin verrentet.“ Bekannte seinen schon in der Obdachlosigkeit oder am Stadtrand gelandet, andere wohnten mit zwei Kindern in einer Zweizimmerwohnung. „Und wenn Leute frustriert sind, kommen sie auf Ideen.“ Gerhard kann sich aber auch ehemalige Mitarbeiter als Täter vorstellen, wegen der Arbeitsbedingungen in den Läden vielleicht, wie er sie von außen wahrnimmt: „Da sind am laufenden Band neue Leute“, mutmaßt er.
Der Schillerburger-Geschäftsführer Ali Cengiz lehnte es ab, mit ZITTY zu sprechen. Der Widerstand gegen die Verdrängung im Schillerkiez war vielleicht selten so radikal wie im Fall der abgebrannten Autos. Aber er war schon stärker. Die meisten Mitstreiter wurden bereits weggentrifiziert.
Schillerkiez-Veteran Gerhard, der seinen Nachnamen nicht nennt, sagt: „Als in den 90ern klar wurde, dass der Flughafen Tempelhof dichtgemacht wird, haben sich viele Hausbesitzer eine Abgeschlossenheitsbescheinigung geholt, die man braucht, um in Eigentumswohnungen umzuwandeln.“ Dadurch hätten die Mieter nach der Öffnung des Flugfelds nicht einmal mehr die sieben Jahre Zeit, die ihnen in Milieuschutzgebieten bei einer Umwandlung zugestanden hätte: „Sie mussten sofort raus. Da wurde die ganze Bewohnerschaft ausgetauscht“, sagt Gerhard. „Jetzt kosten dort 35 Quadratmeter 900 Euro Kaltmiete im Monat. Da liegt ’ne Matratze auf dem Boden und es gibt einen Fernseher und eine Regenwalddusche und plötzlich nutzen Milieuschutz und Mietpreisbremse und alles nichts mehr. Die können verlangen, was sie wollen.“
Was Gerhard anspricht, sind bundespolitische Fragen. Und in Deutschland herrscht dort maßgeblich die CDU. Reiner Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, sagt: „Alle Mietrechtskorrekturen im Bund scheitern an CDU und CSU, die nur Vermieterinteressen im Blick haben.“
Anderswo in Neukölln könnte der Widerstand schon zuvor eskalieren. Die Räumung des Kiezladens in der Friedelstraße 54 steht an. Er bietet verschiedensten Projekten eine Heimat und hat viele Freunde in der linken Szene, darunter einige kampferprobte. Seit dem 1. Juli 2016 ist er besetzt. „Der Tag X wird spannend“, sagt ein linksradikaler Ladensprecher. Im Rahmen einer Aktionswoche, quasi einer Aufwärmübung für die große Straßenschlacht am Tag der Räumung, haben Freunde der „Friedel54“ Ende April das neu eröffnete Fantastic Foxhole Hostel in der Weserstraße 207 von Fahrrädern aus mit grünen Farbbeuteln beworfen. Auf dem Szeneportal Indymedia gibt es ein Bekennerschreiben dazu. Gegen die Umwandlung der Weserstraße in eine „Ballermann-Party-Meile“. Der Kiezladen teilte auf seiner Website auch den Aufruf, das Podiumsgespräch einer Kiezzeitung mit dem AfD-Bundespolitiker Andreas Wild zu verhindern. Die Veranstalter sagten das Treffen vorsorglich ab. In Neukölln ist mit Widerstand von links zu rechnen.
Und ausgerechnet da kommen zwei Jungs aus Düsseldorf und machen einfach ein Hostel auf. Mit Zimmern, in denen zwischen sechs und zwölf Betten stehen. Dreistöckig. Ab 19 Euro die Nacht, 39 Euro für zwei Personen, wenn man sich das Bett teilt. Der Spind steht im Flur, Handtücher und Nachttischlampen gibt es nur gegen Kaution, das Bad wird geteilt und das W-Lan ist gratis. Aus der Bar davor, ebenfalls ohne Tapeten und mit Flohmarkt-Mobiliar, dröhnt mittags schon Techno. Wer hier schläft, ist nicht der Opern wegen in Berlin. Der will trinken und feiern. Natürlich kommt es zu Konflikten mit den Anwohnern. Der Betreiber ist Hagen Wittenborn, er macht gemeinsam mit Martin Hussain auch die Bar im Vorderhaus und will sogar den Club im Keller wieder öffnen, sobald der Brandschutz abgenommen ist. Beide wohnen auch im Haus. Als sie angeblich mitbekamen, dass ihre Gäste von Hausbewohnern beschimpft und bespuckt wurden, sollen sie diese beim Vermieter angeschwärzt haben. Fünf Bewohner wurden jedenfalls fristlos gekündigt. Wegen „nicht nachbarschaftlichen Verhaltens“. Laut Wittenborn und Hussain ging es nur um eine Abmahnung, doch ZITTY liegen die Dokumente vor. Die Betroffenen haben sich Anwälte genommen, die Nachbarschaftsinitiative Weserkiez will sie in ihrem Kampf unterstützen. Beide Betreiber sprachen mit ZITTY, zogen hinterher aber sämtliche wörtlichen Zitate wieder zurück. Vielleicht ist auch das ein Beleg dafür, wie sehr die Nerven in Neukölln gerade blank liegen. Auf allen Seiten.
Den Anwohnern passt es nicht, dass durch das Hostel die Straße noch weiter touristifiziert wird. Der zuständige Neuköllner Stadtrat Jochen Biedermann von den Grünen unterstützt sie – im Rahmen seiner Möglichkeiten. Er hat dem Fantastic Foxhole den Betrieb untersagt, weil Wittenborn und Hussain sich nicht die nötige Genehmigung besorgt hatten. Biedermann verhängte ein Zwangsgeld, weil die Betreiber ihren Laden dennoch offen hielten, doch das beträgt nur 2.000 Euro. Die Miete dürfte deutlich höher sein. Die kommt nur rein, wenn die Betten vermietet sind, die Bar vorne läuft und letztlich auch der Keller bespielt wird. Wenn die beiden tatsächlich ihren Betrieb schließen müssten, um Monate auf die Genehmigung zu warten, würde es wohl ihre Pleite bedeuten.
Das Hostel ist weiterhin über das Internet direkt buchbar. „Super Leute, super Stimmung. Mal chillig, mal Party“, schreibt ein Gast dort. Mit einem hübsch gestalteten und aufwändig gedruckten Flyer luden Wittenborn und Hussain am 1. April die Nachbarn ein, „gemeinsam mit uns zu feiern“. Als Hintergrundmotiv der Einladung verwendeten sie – Corporate Identity – die Tapete ihrer Bar. Allein das schon: eine Provokation für die teils heftig antikapitalistischen Anwohner. Die beiden Düsseldorfer haben viel investiert – und zu verlieren. Sie geben beide gute Jobs auf für ihr Projekt, bezahlen Anwälte, Brandschutzgutachter, einen Architekten und eine PR-Agentur, die sie in dem Kampf um die öffentliche Meinung und gegen das Bezirksamt unterstützen. In den Eingangsbereichen von Hostel und Bar hängen Kameras zu „Sicherheit“.
Die Genehmigung für den Hostelbetrieb haben Wittenborn und Hussain inzwischen beantragt. Stadtrat Biedermann wird sie eventuell durchwinken müssen. „Wir schauen uns das ganz genau an. Aber nach der Bauordnung sind Beherbergungsbetriebe im Wohngebiet möglich“, sagt er. Man hat nicht viel Handhabe als Bezirkspolitiker. Man ist mehr Verwaltung als Politik. Setzt Recht um, anstatt es zu schaffen. Biedermann kann mit den Anwälten der Hostel-Macher um die Auslegung streiten. Das ist alles, was er an Spielraum hat. Bei anderen Sachlagen hat sich das Vorkaufsrecht zuletzt als einigermaßen scharfes Schwert im kommunalen Kampf gegen die Gentrifizierung erwiesen.
Im Park gleich ums Eck vom Fantastic Foxhole sitzt auf einer Bank Katharina. Sie spricht für die stadtpolitische Initiative Weserkiez, die die gekündigten Mieter unterstützt. Katharina war zur Eröffnung nicht eingeladen, weil sie im Nebenhaus wohnt. Sie teilt sich einen Hof mit dem Hostel, traut sich aber nicht mehr, dort vorbeizugehen. Die Fronten sind verhärtet, Kommunikation scheint fast unmöglich.
Katharina sagt: „Ich wohne seit 2001 hier im Haus. Und sehe Touristifizierung und Verdrängung. Aber es brennt ja in ganz Berlin. Der Google-Campus im Kreuzberger Umspannwerk und das Zalando-Hauptquartier auf der Cuvrybrache werden die Stadt noch weiter aufwerten. Für uns ist Nachbarschaft ein politischer Begriff.
Sie darf nicht Kommerzialisierungsinteressen überlassen werde.“ Sie spricht über eine Touristifizierung, die dazu führe, dass massiv in die Lebensqualität eingegriffen werde: der Lärm, die Anreihung von Clubs – oder weil zum Beispiel auf den Kinderspielplatz gekackt würde. All das führe zu einer sozialen Verdrängung. Sie sagt: „Da ist das Maß überschritten. Außerdem bedeutet Touristifizierung immer nur Niedriglohnsektor. Putzen, Bar, Rezeption: Das sind prekäre Arbeitsplätze.“
Um zu überlegen, wie sie die von Kündigungen betroffen Mieter unterstützen können, treffen sie sich an einem Mai-Tag im Vorraum einer Kirche. Verschiedenste Mieterinitiativen waren eingeladen, 23 Menschen sind gekommen. Und der zuständige Stadtrat Jochen Biedermann. Die drei gekündigten Mieter, die erschienen sind, freuen sich sehr. „Es ist ein schönes Gefühl, nicht alleine zu sein“, sagt Julius, einer der beiden. Sie planen Besuche beim Vermieter, eine Plakataktion, eine Demo. Wer länger in Berlin wohnt, der kennt diese Waffen, die wenigen, die man gegen die Verdrängung hat.
Aber es muss nicht so laufen. Es gibt nämlich auch nette Vermieter. Beate Hauke ist eine von ihnen. Sie hat ein Haus im Schillerkiez. Es gehört ihrer Familie seit 1968. „Und meine Kinder werden das auch behalten“, sagt sie. Das Haus sieht von außen etwas heruntergekommen aus, drinnen wohnen nur Freunde und Freunde von Freunden, „und die bleiben da auch. Wenn jemand Probleme hat, die Miete zu zahlen, soll er sich melden. Es gibt für alles eine Lösung. Ich komme gut aus, ich brauche nicht noch mehr.“
Sie hat keine Gastronomie im Haus, aber Räume, die Vereine und Projekte aus dem Kiez für den Kiez nutzen können. Einst hatte sie sogar eine Gruppe von Vermietern gegründet, die sich gegenseitig Mieter vermittelten, die mehr oder weniger Platz brauchten. Inzwischen haben alle anderen aus der Gruppe ihre Häuser verkauft, meist an große Immobilienfirmen. „Ich bin die letzte Einzelvermieterin in der Gegend“, sagt Beate Hauke. Was schade sei, denn den Firmen ginge es immer eher um die Rendite als ums Haus. Die meisten Menschen, die sie hier früher kannte, mussten den Kiez bereits verlassen. Doch sie selbst mag die Veränderung auch irgendwie: „Der viele Hundekot war schon echt schlimm.“
Gerhard, der Mann ohne Nachnamen, hat der Verdrängung bis jetzt widerstanden, vielleicht schafft er es noch eine Weile. Er sagt: „Ich glaube, der Run wird nicht mehr lange dauern. Weil das, was die Stadt attraktiv macht bei jungen Leuten – die freien Orte – verschwindet. Der Senat hofft jetzt auf die Startup-Szene, aber dort werden viele ja auch nur prekär bezahlt. Die haben Nebenjobs in Kneipen.“ Sollte es mit der Start up-Szene klappen, könnte es in Berlin wie in Silicon Valley in den USA werden, wo man locker 1.000 Euro für ein schuhkartongroßes Zimmer zahlt. Mit geteiltem Bad.
Neukölln steht beispielhaft für eine Entwicklung in der ganzen Stadt. Der Hype macht sie hässlich, oder zumindest: öde. Die kleinen, liebevollen, persönlichen Konzepte sind weg, stattdessen übernehmen austauschbare Umsatzbringer. Perfekt zugeschnitten auf die Bedürfnisse der internationalen Besucher: Burger, Betten, Bier. Aber vielleicht gibt es noch Hoffnung, denn es gibt neben Autozündlern und Farbbeutelschmeißern auch noch einen nicht-militanten Arm in der Mieterschutzbewegung. Es gibt viele Demonstrationen zum Thema und gelegentlich erfolgreiche Sitzblockaden gegen Zwangsräumungen. Es werden immer mehr, die sich umschauen und sehen: Wir Mieter sind wirklich viele. Wir sind eine Macht.
In der jungen, zum Teil zugezogenen Anwohnerschaft hört man daher für die Brandstiftung Meinungen von erstaunlicher Bandbreite. Laura, 24: „Das sah schon irre aus, aber ich fands richtig scheiße. Das ist doch gefährlich.“ Nadja, 35: „Ich mag verbrannte Autos. Dit is Balin.“ Alina, 36: „Ich bin total für Militanz. Wir müssen jetzt um unsere Stadt kämpfen.“
Von Verdrängung bedroht zu sein, produziert eben manchmal Wut. Und am heftigsten ist sie in Nord-Neukölln. Hier gibt es besonders viele Menschen, die auf ihre alten Mietverträge angewiesen sind. Und hier – und in Friedrichshain-Kreuzberg – ist es am offensichtlichsten, dass große Teile der Stadt nicht mehr für die Berliner gedacht sind. Da gibt es Hostels, Kneipen und Clubs, wo eigentlich Schulen, Kitas und Freiräume gebraucht würden.
Die Aufwertung wird natürlich auch Vorteile mit sich bringen. Als das Mädchen, das vor der Bar-Eröffnung auf der Straße Drogen konsumiert, fertig damit ist, rümpft sie die Nase und sagt: „Hier ist ja echt alles voller Hundescheiße.“ Später erzählt sie, sie wohne in Prenzlauer Berg. Egal wie weit die Gentrifizierung in Neukölln fortgeschritten sein mag: Dort sieht es einfach nochmal deutlich hübscher aus.
TEXT: MARTIN SCHWARZBECK