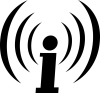Brennende Flüchtlingsunterkünfte, Pegida-Demonstrationen und Spitzen-Wahlergebnisse für die AfD: Was Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus angeht, haben der Osten und insbesondere Sachsen einen schlechten Ruf. Ortsnamen wie Bautzen, Clausnitz, Freital und Heidenau sind zum Synonym für das geworden, was der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck einst als "Dunkeldeutschland" bezeichnete.
Eine Studie des Göttinger Instituts für Demokratieforschung, die an diesem Donnerstag vorgestellt wird und ZEIT ONLINE vorliegt, zeichnet allerdings ein differenzierteres Bild. Acht Monate lang haben sich die Forscher 2016 im Auftrag der Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Länder, Iris Gleicke (SPD), in Freital, Heidenau und Erfurt umgesehen. Dazu haben sie mit Akteuren aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, aber auch mit Bewohnern der Orte gesprochen. Ihr Ergebnis: Zwar werde Rechtsextremismus durch Faktoren befördert, die im Osten stärker ausgeprägt sind. Ostdeutschland unter Generalverdacht zu stellen, mache aber keinen Sinn. Die Verbreitung fremdenfeindlicher Ideen hänge vielmehr stark von der jeweiligen Region, den sozialen Strukturen und der lokalen Politik ab. Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit als primär ostdeutsches oder gar vor allem sächsisches Problem zu bewerten, sei dagegen falsch.
Ein Stadtteil in der Hand von Rechtsextremen
Selbst innerhalb einer Stadt haben die Forscher deutliche Unterschiede festgestellt. In der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt etwa gebe es ein ausgeprägtes Bewusstsein für rechte Tendenzen, sowohl innerhalb der Stadtverwaltung als auch bei der Bevölkerung. Vertreter aller Parteien, ausgenommen die der AfD, der NPD und einige CDU-Mitglieder, würden an Aktionstagen und Demonstrationen gegen Rechtsextremismus teilnehmen.
Auch im Vergleich zu Sachsen schneidet Erfurt deutlich besser ab, so würden rechtsextreme Taten und politische Einstellungen hier kaum relativiert. Eine Ausnahme stellt allerdings der Erfurter Stadtteil Herrenberg dar. Dort habe sich über Jahre eine rechtsextreme Szene "fest in das Stadtviertel integriert", schreiben die Autoren der Studie. Sie sprechen gar von einer "rechtsextremen Vereinsstruktur" mitsamt einem Vereinshaus und "rechtsextremer Erlebniswelt", die sich vor allem an sozial benachteiligte Jugendliche richtet. Diesen wird beispielsweise auch schulische "Nachhilfe" angeboten.
Herrenberg ist eine Plattenbausiedlung, wie es sie in vielen ostdeutschen Städten gibt. Nach 1989 wurde das bis dahin diverse Viertel zu einem Wohnort für jene, die aus finanziellen Gründen dort bleiben mussten. Integrationsfiguren oder soziale Vorbilder seien rar, weswegen Rechtsextreme besonders frei agieren konnten.
Ein zu enger Begriff von "rechtsextrem"
Im Gegensatz zu Herrenberg gebe es in den sächsischen Kommunen Freital oder Heidenau keine derart etablierte rechte Jugendkultur, sondern vielmehr "lose Netzwerke ohne organisatorisches Zentrum". Dazu zähle auch die Bürgerwehr Freital.
Aus dieser war die Gruppe Freital entstanden, eine Gruppierung rechtsextremer Terroristen, deren Gesinnung die sächsische Justiz jedoch nicht erkannte. Die Bundesanwaltschaft übernahm später das Verfahren.
In Freital fanden sich die Forscher auch in zwei Punkten bestätigt: Erstens arbeiteten Behörden mit einer sehr engen Definition des Begriffs rechtsextrem. Und zweitens schüchtere die rechte Szene jene Bürger gezielt ein, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren.
Als "ostdeutsche Erfolgsgeschichten" führten sie hingegen Jena, Leipzig und Hoyerswerda an, die sich gegen den Rechtsextremismus wehren, indem sie ihre Erinnerungskultur – auch auf lokaler Ebene – neu bewerten und lokale Politiker klar gegen rechte Tendenzen auftreten.
Verklärende Erinnerungen
Auch wenn die Forscher eine pauschale Verurteilung des Ostens ablehnen, so sehen sie doch einen Zusammenhang zwischen dem verklärenden Blick auf die DDR-Vergangenheit und rechtsextremem Denken. So werde die Migrationspolitik der DDR, die Migranten zwar begrüßte, aber stets als Gäste behandelte, deren Aufenthalt klar begrenzt war, von vielen Älteren noch heute positiv bewertet. Die DDR-Politik habe insofern ethnozentrische Weltbilder wie sie von modernen Rechten vertreten werden, begünstigt.
Darüber hinaus könne die "Sozialisation in einer buchstäblich geschlossenen Gesellschaft wie der DDR als ein Faktor" für die Entstehung rechtsextremer Einstellungen "nicht stark genug betont werden".
Heute herrsche neben einer ausgeprägten "deutschen" Identität im Osten ein Gefühl der Benachteiligung vor: gegenüber den Westdeutschen, den Städten und Migranten. Weil im Osten der Migrantenanteil nach wie vor niedrig ist, verhindere auch der fehlende Kontakt zu Menschen mit ausländischen Wurzeln, dass Vorurteile abgebaut werden können.
Schwierige Lösung
Ein Problem sei auch, dass es an praktischen Angeboten der politischen Bildung fehle. Positiv sei zwar, dass der Geschichtsunterricht an der gymnasialen Oberstufe in Sachsen mittlerweile wieder verpflichtend sei. In vielen Kommunen im ländlichen Bereich seien es aber nur die Kirchen, die sich mit ihren wenigen Anhängern gegen die rechte Szene stellen.
Stadtverwaltungen wie zum Beispiel in Freital würden die politische Auseinandersetzung über den Umgang mit Rechtsextremismus scheuen oder explizit unterdrücken, möglicherweise aus Angst, das Image ihrer Gemeinden zu beschädigen.
Um dem Rechtsextremismus in Ostdeutschland entgegenzuwirken, sei ein ganzes Bündel von Maßnahmen notwendig, die nur langfristig erfolgreich sein könnten, schreiben die Autoren. So müssten das historische Bewusstsein gestärkt und politische Konflikte offen angesprochen werden – vor allem vonseiten der lokalen Politik. Weil die DDR sich als antifaschistischer Staat begriff, habe man sich auch nicht in gleicher Weise mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinandergesetzt wie im Westen. Positive Beispiele gebe es, auch auf sie solle man sich stärker fokussieren.