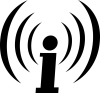Obwohl die Grenzen schon lange dicht sind, gibt es noch immer viele Flüchtlinge in der Region.
Von Thomas Roser, SZ-Korrespondent in Belgrad
Rauchschwaden ziehen durch den verfallenen Eisenbahnhangar. Nur ein fahler Sonnenstrahl, der durch ein klaffendes Loch im Dach fällt, erhellt ein wenig die apokalyptische Szenerie. Hunderte übernächtigt wirkende Männer versuchen, sich in dem improvisierten Flüchtlingslager hinter dem Belgrader Busbahnhof gegen die bittere Kälte mit Decken und an kleinen Feuerstätten zu wärmen.
Seine monatelange Odyssee hat Spuren hinterlassen. Auf dem Boden kauernd taucht der dunkelhaarige Amir mit zwei Leidensgenossen sein Brot in eine selbst gebraute Fleisch-Brühe. Der Gymnasiast aus der afghanischen Stadt Dschalalabad wirkt wie ein Mann Ende 20, doch ist erst 16 Jahre alt. Nachdem sein Vater von den Taliban-Milizen getötet wurde, habe seine Mutter gesagt, er solle nach Europa gehen, erzählt er leise. Vor viereinhalb Monaten brach er aus seiner Heimat in Richtung Italien auf, seit 45 Tagen hängt er in Serbien fest. Die Nächte in dem düsteren Backsteinbau seien eiskalt und stockdunkel: „Aber unser Problem ist nicht der Regen, der hier durch das Dach tropft, sondern die geschlossenen Grenzen.“
In Bulgarien habe ihm die Polizei sein Geld und das Mobiltelefon abgenommen. Bei seinen versuchten Grenzpassagen nach Rumänien und Ungarn sei er auch von den dortigen Gesetzeshütern geschlagen worden, erzählt der afghanische Student Farid. Er wolle nun versuchen, über die kroatische Grenze in den Westen zu gelangen, auch wenn er gehört habe, dass auch Kroatiens Grenzwächter „prügeln und die Flüchtlinge ausrauben“. In eines der überfüllten regulären Lager Serbiens wolle er nicht, da er fürchte, von dort in das nahe Mazedonien deportiert zu werden: „Manchen Bekannten ist das schon passiert. Für Menschen ist diese Halle zwar nicht geeignet. Aber wenigstens werden wir hier nicht schikaniert.“
Selbst in Serbien, das den Flüchtlingen auch wegen der eigenen Kriegsvergangenheit lange relativ verständnisvoll gegenübergestanden hatte, registrieren Hilfsorganisationen einen von der Politik forcierten Wandel. Das Verständnis für die Nöte der Flüchtlinge sinke. Gleichzeitig würden sich Hilfsorganisationen vermehrt dem Behördenvorwurf ausgesetzt sehen, mit ihrer Betreuung die Leute außerhalb der Lager zu halten, berichtet Rados Djurovic, Direktor des Belgrader Zentrums für den Schutz von Asylsuchenden: „Dabei schläft niemand in der Kälte freiwillig in solchen Löchern wie am Belgrader Bahnhof oder unter freiem Himmel. Die Leute wollen nicht in die abgelegenen Lager, weil sie Angst vor illegalen Deportationen haben – und die Zustände auch dort oft alles andere als menschenwürdig sind.“
Feindseligkeit statt Mitgefühl
Vor Jahresfrist wurden die in Richtung Westeuropa ziehenden Flüchtlinge noch von einem Heer von Helfern eskortiert. Doch statt Mitgefühl schlägt ihnen nun auch in den Anrainerstaaten der weitgehend abgeriegelten Balkanroute Gleichgültigkeit oder offene Feindseligkeit entgegen: Die Furcht vor neuen Flüchtlingswellen nach der Drohung des türkischen Staatspräsidenten Recep Erdogan, den Pakt mit der Europäischen Union aufzukündigen, geht mit einer verschärften Gangart gegenüber den ungewollten Grenzgängern einher.
Ob die Ausschreitungen in Bulgariens berüchtigtem Auffanglager Harmanli oder die Brände im Camp auf der griechischen Insel Chios: Nicht nur ihre aussichtslose Situation, sondern auch überfüllte Lager und menschenunwürdige Lebensbedingungen vergrößern die Spannungen unter den Gestrandeten.
So hatten Bulgariens Behörden nach Bürgerprotesten gegen eine vermeintliche Epidemie eine Quarantäne für alle der über 3 000 Bewohner des Lagers Harmanli verhängt. Erst nach den aus dem Ruder gelaufenen Protesten gegen die völlige Abriegelung des Lagers, bei dem ein 15-jähriger Afghane lebensgefährlich verletzt worden war, vermeldeten die Gesundheitsbehörden, dass keinerlei ansteckende Krankheiten entdeckt worden seien.