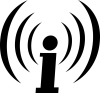Der Thüringer Regierungschef Ramelow spricht im LVZ-Interview über das fragile rot-rot-grüne Bündnis, über Pragmatismus in der Politik und den Umgang mit Neonazis.
Gerade mal eine einzige Stimme mehr hat das Bündnis von Linken, SPD und Grünen im Erfurter Landtag. Das aber sei der Garant dafür, dass es funktioniert, sagt Bodo Ramelow, erster linker Ministerpräsident bundesweit. Über den Umgang Sachsens mit rechtsextremen Aktionen könne er sich nur wundern.
LVZ: Rund zwei Jahre ist es her, da sahen Ihre Kritiker noch das Ende des Abendlandes gekommen. Wie steht es heute um Thüringen, ist das Kapital über den Rennsteig gen Bayern geflüchtet?
Bodo Ramelow: Ganz im Gegenteil. Das Kapital kam jetzt mehrfach her und hat geguckt, ob alles in Ordnung ist.
Von außen betrachtet regiert Rot-Rot-Grün in Thüringen recht geräuscharm – von den Querelen um die Gebietsreform mal abgesehen. Was hat die Kritiker so moderat werden lassen?
Da ist zum einen die Tatsache, dass die drei die Regierung tragenden Parteien auf gleicher Augenhöhe miteinander umgehen. Manchmal streiten wir auch. Aber den Kabinettssaal erreicht das nie, es wird vorher geklärt. Und wenn es sein muss, gebe ich strittige Punkte drei Mal zurück, bis die Frage ausgestritten ist. Zum anderen bin ich seit 26 Jahren in Thüringen und habe die gesamte Transformation mitgemacht. Das heißt, ich kenne sehr viele Betriebe von innen, noch aus der Zeit der großen Sorgen, der Angst und Depression.
Das war in den Wendejahren, als Sie als Gewerkschafter im Lande unterwegs waren …
In dieser Zeit habe ich gelernt, dass Transformation nur gelingen kann, wenn man die Betriebe von innen betrachtet und alle Beteiligten anständig miteinander umgehen. Das ist heute meine Stärke. Ich kann auch in komplizierten Situationen – und davon haben wir einige – gut moderieren.
Die Dreier-Konstellation von Linken, SPD und Grünen mit einem linken Ministerpräsidenten an der Spitze ist bisher einmalig in der Republik. Wie steht es um diesen Feldversuch angesichts einer denkbar knappen Mehrheit von nur einer Stimme?
Dieser scheinbare Nachteil ist unsere Stärke. Die Ein-Stimmen-Mehrheit ist der Garant dafür, dass es funktioniert. Denn das bedeutet, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass wir stets Rücksicht auf den anderen nehmen müssen, um unser Ziel – die langfristige Verbesserung der Lebensbedingungen für die Menschen im Lande – zu erreichen. Und der Weg von jedem zu jedem ist gleich weit, denn die eine Stimme hat jeder der drei. Das ist das Geheimnis der gleichen Augenhöhe.
Das kann aber auch schiefgehen. So wäre die Regierung Ihres CDU-Vorvorgängers Dieter Althaus in Thüringen 2005 beinahe an einer ähnlich knappen Mehrheit zerbrochen. Was macht Sie so sicher, dass Ihnen das nicht passiert?
Weil damals die Ausgangsbedingungen andere waren. Da waren Quertreiber am Werk, die aus persönlichen Interessen den Haushalt vor den Baum setzen wollten. Ich erinnere mich noch: Zur Abstimmung haben wir selbst akut kranke Abgeordnete in den Plenarsaal geholt, da standen Notarztwagen vor der Tür. Das ist mir tief unter die Haut gegangen. Deshalb werde ich nicht zulassen, dass sich so etwas wiederholt. Und nur ganz nebenbei: Bisher haben wir diese eine Stimme zur Mehrheit kein einziges Mal gebraucht – außer bei meinem zweiten Wahlgang zum Regierungschef. Danach nie wieder. Denn sollte in Sachfragen einer von uns aus regionalen Gründen mal nicht mit stimmen wollen, gäbe es Abgeordnete der Opposition, die mit uns stimmen würden – einige ehemalige aus der AfD, aber auch manchmal aus der CDU.
Haben die alten Haudegen von der CDU ihr Herz für Bodo Ramelow entdeckt?
Das vielleicht nicht gerade. Aber sie merken, dass das, was ich mache, kein Teufelswerk ist. Ich fahre ja keine ideologiegeschwängerte Hard-core-Linie, sondern kämpfe nur dann, wenn es sich lohnt. Das führt zu Überschneidungen in der Sache, auch mit der Union. Das politische Klima in Thüringen hat sich schon unter meiner Vorgängerin Christine Lieberknecht an diesem Punkt geändert. Im Gegensatz zu der Zeit davor gibt es an bestimmten Punkten Gemeinsamkeiten mit der Opposition, das praktiziere ich weiter.
Im Gegensatz zu Sachsen …
Richtig. Denn wir reden miteinander. Ich berede die Dinge selbst dann, wenn wir es auch aus eigener Kraft schaffen würden.
CDU-Chef Mike Mohring gab früher gern den Rechtsausleger. Jetzt aber sitzt mit Björn Höcke ein AfD-Vertreter im Parlament, den auch der CDU-Mann kaum rechtsaußen überholen kann. Macht das Mohring handzahm?
Nicht ganz. Schließlich hätte Mohring gern mit der AfD regiert, wenn es ihm geglückt wäre, mich im zweiten Wahlgang durchrauschen zu lassen. Das aber ist misslungen.
Für Misstöne sorgt die geplante Gebietsreform. Warum tun Sie sich das an?
Weil unsere Verwaltungsstruktur problemlos eine Million Bürger mehr verwalten könnte, als tatsächlich vorhanden sind. Wir haben fast die kleinteiligste Gemeindestruktur Deutschlands. Das ist neben der Tatsache, dass wir seit 25 Jahren 450 000 Einwohner verloren haben, unser Problem. Wenn wir nicht rund 8000 Stellen abbauen, wird uns der Landeshaushalt in wenigen Jahren auffressen. Wenn wir das jetzt nicht vorbereiten, fahren wir das Land vor die Wand. Das will ich vermeiden, auch wenn es einigen Ärger mit sich bringt. Wenn ich es mir also gemütlich machen wollte, würde ich die Finger davon lassen – tue ich aber nicht. Denn Thüringen steht wirtschaftlich exzellent da. Wir sind das Industrieland Nummer 1 in Deutschland geworden; auf 1000 Einwohner haben wir die höchste Zahl von Industriearbeitsplätzen.
Das dürfte Ihr Kollege Stanislaw Tillich in Dresden gar nicht gern hören …
Es ist aber die Wahrheit. Unsere Außen- und die Innenwahrnehmung besteht häufig aus Bratwurst und Klößen, die Wirklichkeit aber sieht anders aus. Allerdings haben wir das Problem, dass wir geprägt sind von klein- und mittelständischen Betrieben. Und die großen Konzerne, die hier ihre verlängerten Werkbänke haben, zahlen hier leider keine Steuern.
Gebietsreformen kosten nicht selten den Kopf des Innenministers. Droht dies auch in Thüringen?
Daran scheitert der Innenminister nicht. Der ist nur derjenige, der für alles angenagelt wird. Was scheitern würde, wäre diese Regierung, das ist ganz klar. Ich allerdings bin da ganz entspannt. Ich bin jetzt 60 geworden. Ich muss mir auch nichts mehr beweisen, muss keinem mehr etwas vormachen. Ich kann für mich entscheiden, und deshalb bin ich so entschieden. Für das Thema Gebietsreform heißt das: Ich bin entschlossen, Thüringen zukunftsfest zu machen, und werde genau deshalb diese Frage zum Erfolg führen. Und wenn dies dazu führt, dass ich beim nächsten Mal nicht wieder gewählt werde, nehme ich das auch zur Kenntnis.
Wäre es nicht nett, noch eine zweite Legislatur dranzuhängen?
Alles schön. Nur, ich will das Thema zum Erfolg führen, auch wenn ich deshalb beschimpft werden sollte. Denn es nicht zu tun, wäre ein Frevel an diesem Land.
Gibt es für Sie ein Leben nach der Politik?
Ja, sicher.
In Deutschland existieren ausreichend andere Beispiele …
Für mich gibt es viele Bereiche, auf die ich Lust hätte. Ich habe mir immer auch etwas anderes vorstellen können. Aber klar ist auch: In Thüringen bin ich mittlerweile verwurzelt. Als ich vor 26 Jahren hierher gegangen bin, habe ich gemerkt, dass ich angekommen bin.
Laut aktuellen Umfragen hat Rot-Rot-Grün keine Mehrheit mehr in Thüringen. Eine Folge der geplanten Gebietsreform?
Es gibt eine einzige Umfrage, wo das so ist. Das Problem dabei ist die AfD, die jetzt bei 19 Prozent steht. Die Linke aber liegt weiter stabil bei rund 26 Prozent, die Ankerkräfte von Rot-Rot-Grün sind weiter in Kraft.
Was macht Ihnen mehr Sorgen: Die Schwäche der SPD oder die der Grünen?
Die SPD muss deutlich zulegen, denn wir können das nicht. Das Ergebnis für die Linke in Thüringen ist noch immer das höchste in ganz Deutschland, das heißt, wir füllen unser Potenzial aus. Auf niedrigerem Niveau gilt Ähnliches übrigens auch für die Grünen. Die Einzigen, die Luft nach oben haben, sind die Sozialdemokraten. Dazu aber müssen sie klarer erkennbar werden. Denn sie haben die drei Schlüsselministerien, über die gesteuert werden kann, und will auch, dass sie steuern. Das aber muss aus einem Guss erkennbar sein. So ist es nicht hilfreich, wenn SPD-Häuser sich nicht so ergänzen, wie ich es mir wünschen würde.
Sachsen sorgt immer wieder für Negativschlagzeilen wegen der Übergriffe von Neonazis, doch auch Thüringen ist nicht frei davon. Wie gehen Sie damit um?
Das ist doch keine neue Entwicklung, weder in Sachsen noch in Thüringen. Ich habe mir da nie Illusionen gemacht. Deshalb bin ich so verwundert, dass man in Sachsen so verwundert ist. Wir hatten hier den größten Waffenfund nach 1945, den größten Neonazi-Aufmarsch auch. Der rechtsextreme Thüringer Heimatschutz entstand mit freundlicher Unterstützung von Tino Brandt und dem Verfassungsschutz. Und nicht zuletzt haben mich die beiden NSU-Kader Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt persönlich bedroht. Ich habe eine sehr persönliche und sehr furchtsame Erinnerung an diese beiden Uwes. Diese Bedrohung habe ich bis heute behalten, die spüre ich regelrecht.
Wo liegen die Unterschiede zwischen Sachsen und Thüringen?
Es ist nicht der Umstand, dass es Neonazis gibt. Die gibt es hier wie dort. Es ist vielmehr der Umgang der demokratischen Parteien damit. Als in Pößneck das Schützenhaus von Neonazis gekauft wurde, hat mich CDU-Regierungschefin Christine Lieberknecht gefragt, ob ich dorthin mitfahren würde, um Gesicht zu zeigen. Gemeinsam Gesicht zeigen gegen braunen Ungeist – so hieß das Motto. Sachsen ist davon doch noch meilenweit entfernt.
Warum ist das so?
Dass man in Sachsen so erstaunt reagiert, wenn die Kanzlerin beschimpft wird oder der Bundespräsident, ist das Folge davon, dass man die rechtsextremen Umtriebe lange nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Ganz anders in Thüringen: Seit dem Brandanschlag auf die Erfurter Synagoge im Jahr 2000 hat hier ein Umdenken stattgefunden. Das war nicht ganz freiwillig, es war ein langer Lernprozess. Aber er hat stattgefunden. Und als wir jetzt die Thügidas und Sügidas hatten, waren CDU-Mitglieder bei den Gegenveranstaltungen mit auf der Straße.
Interview: Jürgen Kochinke