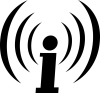Erst Krawalle im Zentrum, dann beim Fußballclub Lok: Leipzig hat ein Gewaltproblem. Verliert die Stadt ihre Lässigkeit? von Martin Machowecz
Es ist nach 22 Uhr an jenem 5. Juni, als im Schutze der Dunkelheit das beginnt, was die Polizei später einen "hemmungslosen Gewaltexzess" nennen wird. Im Johannapark, westlich des Leipziger Zentrums – so rekonstruieren es Ermittler später –, versammelt sich in diesem Moment eine ziemlich finstere Meute. Es sind etwa 100 Menschen, vermummt, aggressiv. Wie auf Kommando setzen sie sich in Bewegung, ziehen in Richtung Innenstadtring. Zerstören Autoreifen, demolieren eine Bushaltestelle, schmeißen einem vorbeifahrenden Reisebus die Scheibe ein. Werfen Pflastersteine, Pyrotechnik, Molotowcocktails auf Polizisten. Beim Abzug attackiert der Trupp das Bundesverwaltungsgericht mit Farbbeuteln und greift Beamte an, die das US-Konsulat bewachen.
Erst dann endet diese Aufführung so schnell, wie sie begonnen hat; in einer Melange aus dem Nebel und Rauch bengalischer Feuer, aus Wut und Schweiß. Diese Nacht war eine Machtdemonstration, eine Kriegserklärung an den Staat und die Polizei. Ein Versuch, Angst zu säen. Allerdings war es weder ein Neonazitrupp, der hier auftrumpfen wollte, noch eine unselige Rockerbande. Nein. Jene, die hier durch Leipzig zogen, geben sich als Linke.
Es ist genau dies, was Leipzig in einen Zustand tiefer Ratlosigkeit versetzt: Wie soll eine Stadt, die so stolz ist auf ihre alternative Subkultur, mit solcher Gewalt umgehen?
Und ausgerechnet jetzt gerät die Stadt auch noch vom anderen Ende des politischen Spektrums her unter Druck, auch dort ist wieder Brutalität erwacht. Gerade erst, am vergangenen Wochenende, rasteten Dutzende Leipziger Hooligans beim Auswärtsspiel des 1. FC Lok Leipzig in Erfurt aus. Eine Viertelstunde vor Spielende stürmten sie das Spielfeld, bedrohten Kicker und Funktionäre, auch Teammanager Mario Basler, der danach erklärte, geschlagen worden zu sein. Die Angreifer, vermummt mit ihren Schals, mit riesigen Sonnenbrillen, verprügelten Ordner mit den bloßen Fäusten. Auch dies war: ein Einschüchterungsversuch.
Das Spiel wurde abgebrochen, der Verein Lok Leipzig, der doch so große Ziele hatte, kurz vorm Aufstieg stand – steigt nun nicht mehr auf, liegt am Boden. Die Entschlossenheit in den Augen der Angreifer, die blanke Wut, man erkennt sie auf den Fotos dieses Nachmittags und denkt, dass so wohl Hass aussehen muss. "Ich habe viel erlebt im Fußball", sagte Mario Basler im MDR, "aber das war, glaube ich, das Schlimmste." Er, gerade noch als Hoffnungsträger bei Lok Leipzig angetreten (ZEIT Nr. 24/15), deutet plötzlich an, dass er Leipzig gleich wieder verlassen könnte, der Gewalt wegen.
Zwei überaus unterschiedliche Vorkommnisse, an zwei Wochenenden. So verschieden sie auch sein mögen, eines liegt auf der Hand: Leipzig, die Hauptstadt der Lässigkeit, hat plötzlich ein Gewaltproblem.
Das Ganze hat natürlich eine Vorgeschichte. Vor Jahren hatten Antifa-Kämpfer etwa die andauernden Großdemos des Neonazis Christian Worch verdrängt. Es gibt bis heute viele, die sagen klammheimlich: Gut, dass wir unsere Autonomen haben. Sie machen die Drecksarbeit im Kampf gegen Rechtsaußen. Politiker wie Enrico Stange, innenpolitischer Sprecher der Linken, verbreiten per Pressemitteilung Sätze wie diesen: "Hundert randalierende Autonome" brächten doch den "Rechtsstaat nicht ins Wanken".
Was nützt diese Relativierung? Die Zeitungen jedenfalls sind jetzt voll von Berichten über den Extremismus von Leipzig; die öffentliche Wahrnehmung, der Blick auf die Stadt hat sich wenigstens vorläufig gedreht, sie ist über Nacht zur Krawallhochburg geworden. Christian Hartmann, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, schimpft: "Wir haben ein linksextremistisch autonomes Problem." Der Politologe Eckhard Jesse aus Chemnitz fordert, es müsse über Linksextremismus diskutiert werden. "Man stelle sich vor, die Krawalle hätten Rechtsextremisten ausgelöst!", sagte er in einem Interview. Zu den Fakten gehört, dass es inzwischen bis zu 180 gewaltbereite Linksautonome in Leipzig gibt. Die perfekt organisiert, schlagkräftig, brutal auftreten – so sieht es der Verfassungsschutz. Und die durchaus im Sinn haben, den Staat auszuhöhlen.
Die Chronik der linksextremistisch motivierten Attacken, 2015 in Leipzig: Am 7. Januar greifen 50 Autonome den Polizeiposten im Stadtteil Connewitz an. Am 15. Januar endet eine Demo von 500 Linken in Gewalt. Am 26. März attackieren mehr als 50 Vermummte das Gebäude der Staatsanwaltschaft mit Pflastersteinen. Am 24. April zerschmettern Steinewerfer am Technischen Rathaus 42 Fensterscheiben. "Wir haben seit Anfang des Jahres eine Gewaltspirale", sagt Polizeichef Bernd Merbitz bei jeder Gelegenheit. Der SPD-Innenexperte im Landtag, Albrecht Pallas, ein früherer Polizist, sagt: "Es wird immer deutlicher, dass sich in Leipzig eine militante Gruppe etabliert hat, die den Staat nicht nur ablehnt – sondern mit gut organisierten Aktionen in schneller Abfolge angreift."
Wie konnte es so weit kommen? Man kann den Sozialpsychologen Oliver Decker fragen, er ist Vorstandssprecher des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus- und Demokratieforschung an der Leipziger Uni. Zufällig war er in der Nähe, als die Linksextremisten am 5. Juni in der Innenstadt wüteten, er sah die Szene aus sicherer Entfernung, sagt: "Im ersten Moment wusste ich gar nicht – sind das Linke? Sind das Rechte?" Der Dresscode unterscheide sich kaum.
Erst später, als im Internet ein Bekennerschreiben auftauchte, wurde ihm klar, wer da unterwegs gewesen sein könnte. Eines, sagt Decker, sei an den Protesten neu: "Überraschend ist, dass sich die Ausschreitung nicht mehr gegen ein konkretes Ziel, etwa einen Aufmarsch der extremen Rechten, richtete. Es scheinen ein willkürlich ausgewähltes Datum, willkürlich ausgewählte Ziele zu sein, es wurde ohne erkennbaren Grund, ohne konkretes Ziel zur Tat geschritten. Es wirkt im ersten Moment so, als ginge es einfach nur darum, irgendetwas zu zerstören."
Decker vermutet zugleich, da schaukelt sich womöglich etwas hoch. Pegida habe den Linken das Gefühl gegeben, dass rechtsextremistische Einstellungen immer mehr in die Gesellschaft einsickerten, salonfähig würden. Stachelt das die Linken an? Es ist keine Neuigkeit, dass die linke Szene auftrumpft. Es ist andererseits ja auch keine Neuigkeit, dass es Ausschreitungen im Fußball gibt; in den Neunzigern waren die vielleicht nicht an der Tages-, aber an der Wochenordnung; einmal wurde damals ein Fußballfan von der Polizei erschossen. Aber die Ereignisse der vergangenen Wochen bedeuten in der Folge auch: Alles, was derzeit in Leipzig geschieht, ist ein Rückschritt. Da erschien Leipzig 2015 in so strahlendem Licht. Und dann das.
Burkhard Jung, Leipzigs Oberbürgermeister, sitzt in einem Café am Hauptbahnhof, gerade hat er hier eine Ausstellung eröffnet. Man sieht ihm an, dass er grübelt, denn diese Frage ist nicht einfach: Fühlen sich die radikal Linken angespornt, weil sie beim Kampf gegen Legida, beim Kampf gegen Rechtsaußen, allzu viel Applaus erhalten haben? Hat Leipzig vielleicht selbst seine Geister heraufbeschworen, die Chaoten ungewollt ermutigt? Jung ist entschlossen: "Nein! Ich habe ein gewisses Verständnis für zivilen Ungehorsam. Wir brauchen manchmal zivilen Ungehorsam, wenn wir uns Nazis entgegenstellen. Aber mein Verständnis endet dort, wo die Gewalt beginnt." Wären die Linksextremisten nicht gewesen, hätten noch mehr Leipziger gegen Legida demonstriert, glaubt er.
Jung sagt auch: "Dass wir solidarisch mit Subkulturen sind, heißt nicht, dass wir solidarisch mit Gewalt wären. Ich bin für Subkulturen und klar gegen Gewalt." Und dennoch ist ja die Frage berechtigt, ob der gewaltbereite Linksextremismus die Kehrseite der schönen Leipziger alternativen Lebensweise ist, ihre schlimmste Ausprägung. Nein, antwortet Jung da wieder. "Ich erwarte aus der Szene, aus der Subkultur, ein klares Bekenntnis gegen Gewalttäter." Zumal, so der SPD-Mann, die Randalierer des 5. Juni überhaupt keine Linken seien! "Diese Leute sind für mich eher Anarchisten, die werfen Pflastersteine auf Polizisten, die lehnen den Staat ab, die betreiben Widerstand gegen die Gesellschaft und den Staat als Ganzes. Die sind gefährlich, und ich verurteile sie aufs Schärfste."
Auch Jung hat beobachtet, dass diese Gruppe sich radikalisiert. "Inzwischen sind diese Anarchisten ein hocheffizient operierender, fast paramilitärischer Trupp, der innerhalb kürzester Zeit überall in der Stadt 100 Leute mobilisieren kann", sagt er. Paramilitärisch? Ja, Jung findet: "Das sind Staatsverächter. Solche Leute gibt es in drei, vier deutschen Städten. Außer in Leipzig vielleicht noch in Berlin, Hamburg, Freiburg." Alles Universitätsstädte. In Leipzig gibt es die Szene, angeblich, vor allem in Connewitz – diesem Viertel im Süden der Stadt. Hier, wo die Altbauten verfielen, eigentlich kaum einer wohnen wollte, konnte man schon in den letzten Jahrzehnten DDR ein freieres, anderes Leben führen. In den Neunzigern entstand, auch weil sich immer wieder Neonazis blicken ließen, eine virile linke Szene.
Ist das der Ort, an dem alles Böse erwächst? Tatsächlich ist man sogar in Polizeikreisen der Meinung, der Ruf von Connewitz sei schlechter, als das Viertel es verdiene. Linksextreme lebten überall in Leipzig. "Connewitz steht nur pars pro toto", sagt auch Oberbürgermeister Jung, "wie eine Marke, ein Schlagwort."
Was tun also? Jung sagt, ihm schwebten tausend Ideen vor. Wie wäre es zum Beispiel damit, ein Transparent aufzuhängen, riesig in seinen Maßen – gegenüber von einem autonomen Zentrum, über eine ganze Hausfassade? "Keine Gewalt", das könnte draufstehen. "Eine Resolution", sagt Jung, "wie 1989! Das wäre ein Zeichen." Die Frage ist dann nur noch, wie lange so ein Plakat unbeschädigt hängen bliebe.