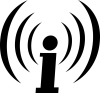1,1 Millionen Menschen starben im größten Vernichtungslager der Nazis, die meisten Täter wurden nie bestraft. Jetzt verstreicht die letzte Chance, das Menschheitsverbrechen zu ahnden: Es geht um 30 SS-Angehörige. Von Klaus Wiegrefe
Die Aktion war präzise organisiert. Die Landeskriminalämter von Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen und Baden-Württemberg schlugen gemeinsam zu, am 19. Februar dieses Jahres, um Punkt neun Uhr. An zwölf Orten fuhren die Ermittler in Zivilautos vor und präsentierten den Verdächtigen Durchsuchungsbeschlüsse. Vorab hatten die Beamten geklärt, ob ihre Zielpersonen über Waffenscheine oder die Erlaubnis verfügten, mit Sprengstoff zu hantieren.
Gegenwehr war von den Verdächtigen freilich kaum zu erwarten. Der Jüngste war 88 Jahre, der Älteste fast ein Jahrhundert alt. Dennoch wurden in Wiernsheim, Gerlingen und Freiburg drei der Beschuldigten vorübergehend festgenommen.
Am folgenden Tag verkündeten die zuständigen Staatsanwaltschaften in Presseerklärungen: "Durchsuchung bei mutmaßlichen ehemaligen SS-Angehörigen des Konzentrationslagers Auschwitz."
Drei Schlüsselwörter in einem Satz: "Durchsuchung", "SS-Angehörige", "Auschwitz". Die Wirkung war ungeheuer. Ob Los Angeles Times, Le Figaro oder El País - weltweit berichteten die Medien über die "größte konzertierte Aktion gegen mutmaßliche NS-Verbrecher seit Jahrzehnten" (Die Welt) .
Auch knapp 70 Jahre nach seiner Befreiung löst Auschwitz Emotionen aus wie kein anderer Ort, an dem die Nazis mit industrieller Effizienz Menschen töteten. Unter den fast sechs Millionen Holocaust-Opfern waren mindestens 1,1 Millionen Juden, die im größten Vernichtungslager des "Dritten Reichs" umgebracht worden waren, zudem mehrere Zehntausend nichtjüdische Polen, sowjetische Kriegsgefangene, Sinti und Roma. Die Ermordeten stammten aus fast allen Ländern Europas, der Großteil wurde unmittelbar nach der Ankunft in Auschwitz-Birkenau vergast.
Die Knochen der Leichen ließ die SS zerkleinern und verkaufte das Knochenschrot an eine Düngemittelfirma in der Nähe. Die Asche der verbrannten Körper wurde zum Straßenbau verwendet, das Haar der Frauen zu Garn gesponnen und Filz verarbeitet, das Zahngold herausgebrochen, eingeschmolzen und der Reichsbank überlassen.
Der Polizeieinsatz am 19. Februar war Teil einer größeren Operation in elf Bundesländern, die sich zunächst gegen 30 ehemalige SS-Angehörige aus dieser Menschenvernichtungsfabrik richtete. Die "Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen" in Ludwigsburg hatte die Fälle identifiziert.
Auf der Liste standen 24 Männer und 6 Frauen, ausschließlich untere Chargen, ehemalige SS-Sturmmänner (entspricht dem Rang eines Gefreiten) oder SS-Rottenführer (entspricht einem Obergefreiten). Sie waren in Auschwitz als Buchhalter tätig, als Sanitäter, Fernschreiberinnen oder - überwiegend - als Wachpersonal. Und viele von ihnen dienten in dem KZ, als 1944 der Transport mit der 15-jährigen Anne Frank eintraf, dem wohl bekanntesten Holocaust-Opfer.
Dass die Beschuldigten eher Befehlsempfänger als Befehlsgeber waren, mindert die Bedeutung der neuen Verfahren keineswegs. Schließlich standen sie alle im Verdacht, als Teil der Mordmaschinerie Beihilfe in insgesamt vielen Tausenden Fällen geleistet zu haben.
Der konzertierte Aufschlag aus Ludwigsburg verfehlte seine Wirkung nicht. Mit Beachtung quittierte die Öffentlichkeit, dass die deutsche Justiz noch einmal versuchte, die wohl beschämendste Bilanz ihrer Geschichte aufzubessern.
Denn die juristische Verfolgung des Jahrhundertverbrechens Auschwitz stand bislang in krassem Gegensatz zum Ausmaß des Vergehens. Der Historiker Andreas Eichmüller hat nachgezählt: Von den 6500 SS-Leuten, die in Auschwitz Dienst getan und den Krieg überlebt hatten, wurden in der alten und neuen Bundesrepublik nur 29 verurteilt (und rund 20 in der DDR).
Längst gilt das Versagen der Justiz als Teil jener "zweiten Schuld", die der Schriftsteller und Holocaust-Überlebende Ralph Giordano den Deutschen bereits 1987 vorhielt - weil sie die Hitlerjahre allzu lange verdrängt und die eigene Schuld verleugnet hätten.
Inzwischen ist ein gutes halbes Jahr seit der Polizeiaktion verstrichen, und immer klarer zeichnet sich ab, dass die Annahme fehlging, die Strafverfolger würden mit einem letzten Aufbäumen den Massenmord in Auschwitz zumindest in Ansätzen sühnen. Beinahe im Wochenrhythmus werden die neuen Verfahren eingestellt: weil einige ehemaligen SS-Männer verstarben, weil viele sich als verhandlungsunfähig erwiesen, weil einer entgegen den Ludwigsburger Ermittlungen doch nicht zur Lagermannschaft von Auschwitz zählte, weil ein anderer bereits in den Nachkriegsjahren von einem polnischen Gericht bestraft worden war.
Die in Baden-Württemberg und später in Mecklenburg-Vorpommern verhafteten einstigen SS-Männer sind längst wieder zu Hause. War das Vorgehen der Staatsanwaltschaft also "völlig überzogen", wie Peter-Michael Diestel kritisiert? Der letzte Innenminister der DDR, der heute als Strafverteidiger tätig ist, vertritt den ehemaligen Unterscharführer Hubert Z.
Ernsthaft ermittelt wird allenfalls noch in acht Fällen. So scheint ein besonders unwürdiges Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte ein ihm entsprechendes Ende zu finden. Und natürlich steht der Verdacht im Raum, die Strafverfolger in Ludwigsburg und einige Staatsanwaltschaften hätten billig PR-Punkte sammeln wollen, indem sie einige Rollatorfahrer mit brauner Vergangenheit einbuchteten.
Auschwitz und die deutsche Justiz. Es ist die Geschichte eines Scheiterns, über dessen Gründe gerätselt wird, zumal das Angebot an Erklärungen groß ist - und voller Widersprüche:
Sind die Versäumnisse vor allem in der Adenauer-Ära zu finden, wie Christoph Safferling behauptet? Safferling zählt zur Historikerkommission, die im Auftrag des Bundesjustizministeriums dessen Umgang mit der Nazizeit beleuchtet. Der Rechtsprofessor sagt, man habe später nicht mehr korrigieren können, was Politik und Justiz in den ersten Nachkriegsjahrzehnten versäumt hätten.
Oder befand sich die deutsche Justiz noch in den letzten Jahrzehnten im "Blindflug", wie sein Kölner Kollege Cornelius Nestler erklärt?
Lag es an den vielen Nazis, die nach Kriegsende ihre Karriere im Justizdienst fortsetzten? Aber warum kam es nach der Pensionierung dieser Generation in den 1980er-Jahren nicht zu einer neuen Prozesswelle? Die letzte Hauptverhandlung in Sachen Auschwitz endete vor über 20 Jahren.
Vielleicht ist das deutsche Strafrecht auch grundsätzlich ungeeignet, "staatlich betriebenen, bürokratisch organisierten Massenmord zu erfassen", wie der US-Historiker Devin O. Pendas schreibt. Möglicherweise ist die Antwort aber auch in der Konrad-Adenauer-Straße 20 in Frankfurt am Main zu finden. Dort sitzt jene Staatsanwaltschaft, die den Großteil der Verfahren zu Auschwitz führte - und sie meistens einstellte.
Der hat auf seiner Spurensuche Unterlagen aus Ermittlungsverfahren eingesehen und in Archiven recherchiert. Er hat mit Historikern und Rechtsgelehrten gesprochen, mit Staatsanwälten und Richtern aus Auschwitz-Verfahren, mit Verteidigern der ehemaligen SS-Angehörigen und mit einer Auschwitz-Überlebenden.
Die Ahndung von Auschwitz scheiterte zumeist nicht daran, dass einige Politiker oder Juristen sie hintertrieben hätten. Sie scheiterte, weil sich zu wenige fanden, die entschlossen die Täter überführen und bestrafen wollten. Der Massenmord von Auschwitz war vielen Deutschen vor 1945 egal - und danach auch.
Dass es schwierig werde, die Untaten der Nazis zu ahnden, hatten die Alliierten bereits während des Krieges vorausgesehen: Die Zahl der Täter war groß, die rechtliche Lage diffizil. Durften die Alliierten etwa juristisch verfolgen, was Hitler jüdischen und anderen Deutschen angetan hatte? Nach internationalem Recht müsse man daran zweifeln, räumte Londons Außenminister Anthony Eden 1942 während einer Kabinettssitzung ein, so etwas könne leider "nicht als Verbrechen angesehen" werden.
Um das "Wirrwarr eines rechtsstaatlichen Verfahrens" zu vermeiden, wollte Großbritanniens Premier Winston Churchill zumindest die führenden Nazis "ohne Überweisung an eine höhere Gewalt" erschießen lassen. Später unterschrieb er die berühmte Moskauer Erklärung von 1943. Danach behielten sich die Siegermächte die "Hauptverbrecher" vor. Ansonsten galt: Wer "Grausamkeiten, Massaker und Exekutionen" zu verantworten hatte, sollte in jenem Land vor Gericht gestellt werden, in dem er die Taten begangen hatte.
Während des Krieges gehörte der Teil Schlesiens, in dem Auschwitz liegt, zum "Dritten Reich". Nach 1945 fiel die Region an Polen zurück. Und so lieferten die Westmächte jene SS-Leute, die sie bei Militärkontrollen oder in Kriegsgefangenenlagern fassen konnten, an die Regierung in Warschau aus.
Als berühmtester Fall gilt der langjährige, brutale Lagerkommandant Rudolf Höß, der sich auf einem Bauernhof bei Flensburg versteckt hatte. Ein britisches Ermittlerteam soll der Ehefrau gedroht haben, den ältesten Sohn den Sowjets zu übergeben; da habe Hedwig Höß ihren Mann verraten. Höß wurde in Warschau zum Tode verurteilt und vor seinem ehemaligen Kommandantenhaus gehenkt.
Knapp 700 SS-Angehörige aus Auschwitz sind von polnischen Richtern zur Verantwortung gezogen worden, und nach Einschätzung des Historikers Aleksander Lasik ließen diese sich "nicht von Rache leiten". Manche Urteile fielen sogar erstaunlich milde aus. Allerdings sprachen die Gerichte in Krakau, Kattowitz oder Wadowice auch dann mehrjährige Freiheitsstrafen aus, wenn sich lediglich die Mitgliedschaft in der SS-Mannschaft eines Lagers nachweisen ließ.
Mitgefangen, mitgehangen.
Der deutschen Justiz blieb zunächst nur vorbehalten, jene Verbrechen zu sühnen, die von Deutschen an Deutschen begangen wurden. Doch auch dies erwies sich als schwierig, wie Edith Raim vom Institut für Zeitgeschichte festgestellt hat: Im zerbombten Nachkriegsdeutschland fehlten Räume, Kohle zum Heizen, Telefone, Schreibmaschinen. In einigen Städten musste der Justizbetrieb bei Einbruch der Dunkelheit mangels Glühbirnen eingeschränkt werden. In Hamburg konnten aufgrund der Papierknappheit zeitweise keine Urteile ausgefertigt werden.
Viele Straßen und Bahngleise waren zerstört, das Land war in Besatzungszonen aufgeteilt, zwischen denen man nur mit Erlaubnis der Alliierten reisen durfte. Wollte ein Staatsanwalt aus Süddeutschland einen Zeugen in Hamburg befragen, dauerte allein der Postweg für eine Strecke sechs Wochen.
Und doch wird niemand behaupten können, dass die Strafverfolgung an Glühbirnen scheiterte. Der Holocaust stieß im Gegensatz zu anderen NS-Verbrechen von Beginn an auf geringes öffentliches Interesse. Als die Amerikaner im Oktober 1945 eine Meinungsumfrage in ihrer Besatzungszone durchführten, erklärten 20 Prozent der Befragten, "mit Hitler in der Behandlung der Juden" übereinzustimmen; weitere 19 Prozent fanden seine Politik gegenüber den Juden zwar übertrieben, aber grundsätzlich richtig.
Obwohl Experten schätzen, dass einige Zehntausend Auschwitz-Opfer aus Deutschland stammten, standen bis zur Gründung der Bundesrepublik 1949 nicht einmal ein halbes Dutzend SS-Leute aus Auschwitz vor Gericht. Und als die Alliierten der westdeutschen Justiz die Verfolgung aller NS-Verbrechen überließen, wurde es zunächst auch nicht besser.
Bereits in den ersten Verfahren ist ein beträchtlicher Mangel an Empathie zu beobachten, selbst wenn es zu einer Verurteilung kam. Das Landgericht Nürnberg-Fürth etwa beschrieb die Häftlinge eines Außenlagers von Auschwitz als "schwer erziehbare polnische Juden", denen es an "Konzentrationslagererfahrung" gefehlt habe.
Konzentrationslagererfahrung - auf so ein Wort muss man erst mal kommen.
Zwei Jahre später sprach das Landgericht Wiesbaden Gerhard Peters frei, den Geschäftsführer der Firma Degesch, die Zyklon B an die SS geliefert hatte. Peters' Ansprechpartner bei der SS hatte ausgesagt, er habe das angelieferte Gift zum Desinfizieren verwendet. Das Gericht erkannte auf "erfolglose Beihilfe".
Womöglich gingen Staatsanwälte und Richter mit einer braunen Vergangenheit eher unwillig an NS-Verbrechen heran. In Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen lag ihr Anteil bei über 80 Prozent. Selbst der Bundesgerichtshof wies lange ähnliche Werte auf.
Andererseits hat der Historiker Ulrich Herbert auf den "geduckten Opportunismus" ehemaliger Nazis verwiesen, die sich nicht trauten, offen zu opponieren. Bislang ist jedenfalls kein Fall eines belasteten Staatsanwalts oder Richters bekannt geworden, der die Ahndung von Auschwitz aktiv verhindert hätte.
Es war viel einfacher: Nichtstun genügte. "Der Friede mit den Tätern wurde auf den Rücken der Opfer geschlossen", bilanziert der Hamburger Rechtsprofessor Ingo Müller in der Neuauflage seiner berühmten Generalabrechnung mit dem eigenen Berufsstand ("Furchtbare Juristen").
Und wenn es doch einmal zum Prozess kam, zeigten auch unbelastete Juristen große Kreativität. Besonders beliebt: Täter als Gehilfen einstufen, was das Strafmaß deutlich senkt. Reihenweise kamen hochrangige SS-Angehörige der Vernichtungslager mit niedrigen Strafen davon. Frustrierte Ermittler formulierten die Faustregel, pro ermordeten Juden gebe es zehn Minuten Haft.
Der SS-Lagerarzt Johann Kremer aus Münster verließ 1960 das dortige Landgericht sogar als freier Mann, obwohl er kranke oder erschöpfte Häftlinge hatte ermorden lassen. Kremer benötigte Organe für seine medizinische Forschung, in seinem Tagebuch notierte er am 10. Oktober 1942: "Lebendfrisches Material von Leber, Milz und Pankreas entnommen und fixiert".
Doch das Gericht befand, dem ehemaligen SS-Obersturmführer habe ein "eigenes Interesse an der Tat" gefehlt, daher sei er nur Gehilfe - und nicht Täter. Kremer erhielt zehn Jahre Zuchthaus statt lebenslänglich, was sich vermutlich nicht zufällig genau mit jener Strafe deckte, die er in Polen bereits abgesessen hatte.
Hinter der sogenannten Gehilfenkonstruktion stand die Wunschvorstellung, nur Hitler und seine Entourage seien für den Holocaust verantwortlich gewesen. Alle Übrigen, spottete der legendäre hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, betrachteten sich als ,"vergewaltigte, terrorisierte Mitläufer oder depersonalisierte und dehumanisierte Existenzen, die veranlasst wurden, Dinge zu tun, die ihnen vollkommen wesensfremd gewesen sind".
Die Deutschen als Hitlers Opfer. So sah es der Zeitgeist, der noch in der Ära Willy Brandts den Tätern beistand. Selbst ausgewiesene Nazigegner wie Kanzler Konrad Adenauer glaubten, auf die Schlussstrichmentalität Rücksicht nehmen und das Legalitätsprinzip brechen zu müssen. Zu den erstaunlichsten Dokumenten, die in den vergangenen Jahren bekannt wurden, zählt der Vermerk eines Gesprächs Adenauers mit einem israelischen Diplomaten 1963. Israel drängte auf die Aufnahme diplomatischer Beziehungen, und Adenauer deutete an, diesem Begehren nachzukommen - wenn Israel im Gegenzug akzeptiere, dass die Bundesrepublik die NS-Strafverfolgung einstelle. Diese sei "für das Ansehen Deutschlands in der Welt unerträglich".
Vermutlich wäre es Anfang der Sechzigerjahre nie zu dem großen Frankfurter Auschwitz-Prozess gekommen, wenn sich nicht Generalstaatsanwalt Fritz Bauer des Themas angenommen hätte. Der Sozialdemokrat aus Schwaben war in vielfacher Hinsicht ein Außenseiter: ehemaliger KZ-Häftling, Emigrant, Jude, Homosexueller. Er wollte nicht nur Gerechtigkeit für die Opfer, sondern auch die "Feststellung und möglichst allseitige Erkenntnis der Wahrheit". Der Zigarrenraucher plante, mit einem großen Auschwitz-Prozess das kollektive Schweigen zu durchbrechen.
Eine Folge glücklicher Umstände spielte Bauer in die Hände. Ein Journalist der Frankfurter Rundschau übergab ihm Unterlagen, die er von einem Auschwitz-Überlebenden bekommen hatte. Es handelte sich um Schreiben, in denen die Lagerleitung das SS- und Polizeigericht XV in Breslau 1942 ersuchte, Ermittlungsverfahren gegen 37 namentlich genannte SS-Männer einzustellen, die Häftlinge erschossen hatten. Solche Ermittlungsverfahren gehörten zur scheinlegalen Fassade des Vernichtungslagers.
Mit den Namen der Schützen hatte Bauer einen Hebel in der Hand. Er erwirkte beim Bundesgerichtshof, dass dieser die "Strafsache gegen die früheren Angehörigen der Kommandantur des Konzentrationslagers Auschwitz" dem Landgericht Frankfurt übertrug. Damit war die Bauer unterstellte Anklagebehörde zuständig.
Dann beauftragte Bauer einige unbelastete Staatsanwälte mit den Ermittlungen. Und die jungen Männer zeigten, wie leicht es war, die Causa Auschwitz voranzutreiben - wenn man nur wollte. Sie baten jüdische Organisationen um Hilfe, riefen in Zeitungen Zeugen auf, sich zu melden, sichteten in Auschwitz Dokumente. Innerhalb weniger Monate hatten die Juristen knapp 600 SS-Angehörige ermittelt, wie Bauer-Biograf Ronen Steinke berichtet.
Jetzt wurde systematisch und über die Medien gefahndet, was zu Richard Baers Enttarnung führte, des letzten Auschwitz-Kommandanten, der unter falschem Namen auf den Ländereien der Bismarcks im Hamburger Sachsenwald arbeitete.
Bauer wies die Ankläger an, einen "Querschnitt durchs Lager" vor Gericht zu stellen. Er wollte die Täter nicht in Einzelprozessen aburteilen, bei denen die "Ermordung von A durch X, B durch Y oder von C durch Z" (Bauer) verhandelt wurde. Eine solche Prozessführung hätte verschleiert, warum der Holocaust auf so fürchterliche Weise effizient war: weil die Nazis in der Menschenvernichtungsfabrik arbeitsteilig vorgingen.
Das Reichssicherheitshauptamt, die Terrorzentrale der SS in Berlin, kündigte per Funkspruch oder Fernschreiben die Ankunft eines Zuges mit Juden an. Die Kommandantur unterrichtete die zuständigen Abteilungen. Dem Dienstplan ließ sich entnehmen, wer Rampendienst leisten musste. Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Motorrad kamen die SS-Leute zur Rampe, die bis 1944 an einem Nebengleis des Güterbahnhofs von Auschwitz stand.
Dort wurden die ahnungslosen Häftlinge in zwei Gruppen geteilt. Die einen kamen ins Lager und mussten fortan als Zwangsarbeiter schuften. Die anderen bestiegen Lastwagen, die zu den Gaskammern fuhren, oder marschierten dorthin. Die SS suchte den Eindruck zu erwecken, es handle sich um Duschräume. Sogenannte Desinfektoren warfen von außen Zyklon B durch Schächte; SS-Ärzte warteten in der Nähe - um zu helfen, falls sich die Mörder versehentlich vergifteten.
Und Bauer legte diese Struktur offen.
Am 20. Dezember 1963 begann im Frankfurter Römer der bedeutendste deutsche NS-Prozess der Nachkriegsgeschichte: "Strafsache gegen Mulka und andere". Die Hauptverhandlung war ein Meilenstein historischer Aufklärung. Insgesamt 20 000 Besucher folgten ihr, die Gerichtsgutachten wurden Bestseller, täglich berichteten die Medien von den Aussagen der über 350 Zeugen - und brachten das Wissen um den Holocaust in die Wohnzimmer.
Zuschauer brachen in Tränen aus, wenn ehemalige Häftlinge wie der ungarische Arzt Dr. Lajos Schlinger ihr Schicksal erzählten. Der nichts ahnende Jude hatte bei der Ankunft an der Rampe unter den SS-Leuten Dr. Victor Capesius ausgemacht, den Leiter der Lagerapotheke. Vor dem Krieg war Capesius als Vertreter der Pharmafirma Bayer mehrfach bei Schlinger gewesen. Und so lief der Arzt freudig auf den SS-Mann zu, um ihn zu fragen, wo man sei und was nun geschehen werde, denn Schlingers Frau war krank. Capesius beruhigte ihn, alles werde gut: Frau Schlinger und die 17-jährige Tochter mögen sich bei den Schwerkranken anstellen. Mit den Worten "Du sollst dort hinübergehen" schickte Schlinger seine Liebsten in den Tod.
Heute wird Bauer dafür gefeiert, den Prozess gegen alle Widerstände durchgesetzt zu haben; ebenso ließe sich argumentieren, Bauers Beispiel sei ein Beleg dafür, dass Wille und Entschlossenheit eines Einzelnen ausreichten. Und Standfestigkeit.
Ermittler wie Staatsanwälte wurden noch Jahrzehnte nach Hitlers Untergang von Vermietern schikaniert, erhielten Morddrohungen, hatten mit Schmierereien im Hausflur zu leben. Bauer bekam eine Pistole Kaliber 6,35 Millimeter, sein Fahrer fungierte zugleich als Leibwächter.
Zu den wenigen, die noch über die damalige Stimmung in der Justiz erzählen können, gehört der ehemalige Untersuchungsrichter im Auschwitz-Verfahren Heinz Düx, 90. Der kleine Mann mit dem Musketierbart ist bis heute ein bekennender Linker. Er hat ein ums andere Mal "Geheimvermerke" geschrieben, wenn wieder ein Kollege versuchte, die Ermittlungen zu hintertreiben, etwa mit dem geheuchelten Vorwand, das sei doch alles zu viel Arbeit für das Landgericht.
Da waren die beiden Landgerichtsräte, die vorschlugen, den geplanten Großprozess in Einzelverfahren aufzulösen und einen Teil dann an andere Staatsanwaltschaften abzugeben - Bauers Konzept eines Mamutverfahrens wäre geplatzt. Da war der Regierungsdirektor, der eine Anfrage Düx' an die sowjetische Botschaft wochenlang mit dem Hinweis blockierte, in dem Schreiben müsse die DDR als Sowjetische Besatzungszone bezeichnet werden. Da waren der Landgerichtspräsident und ein Staatssekretär, die sich weigerten, eine Dienstreise von Düx nach Auschwitz zu bewilligen.
Düx kann von Kollegen berichten, die Zeugen aus dem Vernichtungslager intern als "Berufs-Auschwitzer" diffamierten. Allerdings sagt er auch, das Verfahren sei zu keinem Zeitpunkt ernsthaft gefährdet gewesen. Bauer, Düx und einige Gleichgesinnte - das genügte, um einen solchen Prozess auf die Beine zu stellen.
Auf das Urteil allerdings hatte Bauer keinen Einfluss, und erst kürzlich ist Werner Renz vom Fritz Bauer Institut dem fatalen Erbe des Urteilsspruchs nachgegangen. Dieser lieferte jenen Richtern und Staatsanwälten einen Vorwand, die unwillig waren, sich der Verbrechen in Sachen Auschwitz anzunehmen. Die wenigen anderen entmutigte es.
Denn die Strafen gegen einige hochrangige Lagerfunktionäre fielen "empörend niedrig" (Renz) aus, wovon deren Untergebene profitierten. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt stellte etwa das Verfahren gegen 14 Lkw-Fahrer ein, die Zyklon B und die Opfer zu den Gaskammern gekarrt hatten. Begründung: Gemessen an den Schuldsprüchen gegen SS-Angehörige, die an der Rampe selektiert hatten, erscheine die Schuld der Fahrer "gering".
Vor allem aber scheiterte Bauer mit einem juristischen Kniff, der alles verändert hätte: Der Generalstaatsanwalt hatte nämlich argumentiert, der Judenmord von Auschwitz bestehe nicht aus einer Vielzahl einzelner Straftaten, sondern sei als eine Tat zu werten. Was akademisch klingt, hätte erhebliche Konsequenzen gehabt: Jedes Mitglied der SS-Lagermannschaft wäre, so Bauer, prinzipiell wegen "Mitwirkung am Morde" schuldig gewesen: "von der Wachmannschaft angefangen bis zur Spitze".
Aber sowohl das Frankfurter Landgericht als auch der Bundesgerichtshof im Revisionsverfahren verwarfen die Konstruktion, was sich als Befreiungsschlag für jene Tausende SS-Leute erwies, denen nur nachzuweisen war, dass sie in Birkenau Dienst getan hatten. Rädchen im Getriebe gewesen zu sein reichte für eine Verurteilung demnach nicht aus.
Fortan orientierten sich Staatsanwälte und Gerichte an diesem Karlsruher Spruch zu Auschwitz - obwohl der Bundesgerichtshof bei anderen Vernichtungslagern eine Position vertrat, die sich im Einklang mit der Bauer-Linie befand, wie Rechtsprofessor Nestler herausgefunden hat.
Statt einer Anklagewelle gegen die niederen Chargen folgten auf den großen Auschwitz-Prozess lediglich eine Handvoll Hauptverfahren. Und zumeist erwies es sich als unmöglich, einen konkreten Tatbeitrag nachzuweisen.
Das Verstreichen der Zeit wurde zum mächtigsten Verbündeten der SS-Veteranen. So endete der Prozess um ein besonders fürchterliches Verbrechen 1976 mit einem Freispruch des SS-Führers Willi Sawatzki, weil der wichtigste Belastungszeuge nicht mehr vernehmungsfähig war. Es ging um den Mord an rund 400 ungarischen Kindern. Den SS-Leuten war das Zyklon B ausgegangen, und so fuhren sie die Kinder zu Gruben und warfen sie lebend ins Feuer. Mit Fußtritten trieben SS-Männer die Kleinen zurück in die Flammen, wenn diese sich zu retten suchten. Ein Augenzeuge berichtete später von "kleinen Feuerbällen, die man aus den Scheiterhaufen kriechen sehen konnte".
Weil der Bundesgerichtshof Auschwitz-Verfahren routinemäßig an die Frankfurter Staatsanwaltschaft verwies, wurde beinahe die gesamte Strafverfolgung der Lagerverbrechen zur Angelegenheit von nicht einmal einem Dutzend spezialisierter Juristen. Nach einer Erhebung des Instituts für Zeitgeschichte führten die Frankfurter 1060 Verfahren - und stellten fast alle ein. Noch hat niemand die Akten im Hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden systematisch ausgewertet, doch es scheint, dass mit jedem Misserfolg die Motivation der Ankläger sank.
Wie anders lässt sich der Zynismus in Vermerken erklären, die dem vorliegen? Etwa zu einem SS-Wachmann im Jahr 1982. Der Mann hatte einige Male an der Rampe gestanden, um die Flucht ankommender Juden zu verhindern. Doch Oberstaatsanwalt Hans Eberhard Klein befand, die Opfer hätten nicht gewusst, was ihnen bevorstand. Folglich wollten sie nicht fliehen, der Wachmann habe sie daher an einer Flucht nicht hindern können.
Die Logik von Juristen, die einen Notausgang suchten.
Oder 2005, als es um einen Angestellten der "Häftlingsgeldverwaltung" ging, die für die Habe der Ermordeten zuständig war. Deren Ausplünderung sei nicht Ursache des Verbrechens, sondern "lediglich ein willkommenes Nebenprodukt für die Kriegswirtschaft" gewesen, argumentierte Staatsanwalt Eberhard Galm. Im Übrigen müsse in Zweifel gezogen werden, dass dem SS-Unterscharführer die "Grausamkeit des Todeseintritts durch qualvolles Ersticken an Blausäuredämpfen bewusst war".
Fall erledigt, Akte zu.
Irgendwann erlahmte auch das Engagement der Zentralen Stelle (ZSt) in Ludwigsburg, deren Vorarbeiten die Frankfurter Verfahren zumeist auslösten. "Auschwitz war bei der Justiz gedanklich abgeschlossen", räumt ZSt-Chef Kurt Schrimm ein. Und vermutlich wäre es im Februar nie zu der Polizeiaktion gegen die ehemaligen SS-Leute gekommen, wenn der Ludwigsburger Ermittler Thomas Walther 2008 nicht den Versuch unternommen hätte, den ehemaligen SS-Wachmann John Demjanjuk aus dem Vernichtungslager Sobibór vor Gericht zu bringen.
Walther war neu in Ludwigsburg, furchtlos und wunderte sich über die intellektuelle Trägheit vieler Kollegen. Lange lächelten sie über ihn, doch zur allgemeinen Überraschung sprach das Landgericht München Demjanjuk - der nach dem Krieg in den USA lebte, aber ausgeliefert worden war - schuldig. Das Urteil gegen den gebürtigen Ukrainer, dem man keine konkrete Einzeltat nachweisen konnte, wirkte wie ein Startsignal. Auf einmal waren die niederen SS-Chargen von Auschwitz wieder ein Thema:
‣ Plötzlich entdeckten Ludwigsburger Juristen Parallelen zwischen Auschwitz und den Anschlägen vom 11. September 2001. Ihr Fokus richtete sich dabei auf den Hamburger Studenten Mounir al-Motassadeq. Der Marokkaner wurde seinerzeit als Komplize des Terrorpiloten Mohammed Atta der Beihilfe zu tausendfachem Mord angeklagt. Motassadeq hatte Attas Abwesenheit in der Hansestadt kaschiert und geholfen, Geld an die Attentäter in den USA zu transferieren. Aber er hat niemanden umgebracht, im Gegensatz zu SS-Leuten in Auschwitz war er sogar Tausende Kilometer vom Tatgeschehen entfernt. Und wie niedere SS-Chargen konnte er behaupten, die Morde wären auch ohne seine Mitwirkung durchgeführt worden. Dennoch hielt der Bundesgerichtshof Motassadeq 2006 der Beihilfe für schuldig.
‣ Jetzt stellten die Ludwigsburger fest, dass es nicht nur das Frankfurter Auschwitz-Urteil gab, sondern dass Gerichte bereits in den 1960er-Jahren gewöhnliche Hilfskräfte von anderen Vernichtungslagern zur Verantwortung gezogen hatten. So musste ein SS-Buchhalter aus Sobibór auch wegen seiner Verwaltungstätigkeit ins Zuchthaus.
‣ Nun erinnerten sich die Ermittler an Listen Tausender SS-Leute aus Auschwitz, die schon zu Fritz Bauers Zeiten angelegt worden waren.
Wie bei der Rasterfahndung sortierten die Strafverfolger alle aus, die vor 1912 geboren waren, weil diese vermutlich nicht mehr lebten. Die verbliebenen Daten legten die Ermittler der Renten- und anderen Versicherungen vor. Am Ende hatten die Ludwigsburger 30 Namen und Adressen, die sie im Herbst 2013 an die zuständigen Staatsanwaltschaften in den jeweiligen Wohnorten weitergaben.
Es sind üble Gestalten darunter, die schon vor Jahrzehnten von den Alliierten oder in der DDR hohe Haftstrafen erhielten. Ins Visier der Ludwigsburger gerieten sie alle jedoch nicht aufgrund konkreter Tatbeiträge, sondern weil sie Teil der Maschinerie waren, die das systematische Töten betrieb.
Wie Hermine G., die als Sekretärin in der Fernschreibstelle der Kommandantur arbeitete, von der aus Mitteilungen über die ermordeten Juden nach Berlin gingen. Oder wie der Wachmann Jakob W., der zweieinhalb Jahre im Lager Dienst tat, vorwiegend auf dem Turm. "Klar, wenn wir nicht dort gewesen wären, hätte es Auschwitz nicht gegeben", räumt er ein. Aber schuldig fühlt sich der spätere Architekt und deutsche Beamte weder im strafrechtlichen noch im moralischen Sinn ( siehe Seite 36 ).
Das Greisenalter der Beschuldigten spielt in der juristischen Bewertung keine Rolle. Natürlich erscheint es vielen Betrachtern absurd, 88-Jährige nach dem Jugendstrafrecht für Taten zu verurteilen, die 70 Jahre zurückliegen.
Aber was ist gerecht?
Ein Besuch bei Esther Bejarano, der 89-jährigen Vorsitzenden des Auschwitz-Komitees. Sie kam als junge Frau in das Vernichtungslager. Sie hat dort überlebt, weil sie musikalisch ist. Die SS brauchte sie für das Mädchenorchester des KZ.
Bejarano lebt in einer kleinen Wohnung in Hamburg. Sie sprüht trotz ihres hohen Alters vor Energie, in Prozessen gegen ehemalige SS-Leute mochte sie allerdings nie auftreten. Sie sagt, sie ertrage eine solche Belastung nicht. Natürlich begrüßt sie die neuen Ermittlungen, wenn auch voller Bitterkeit: "Das ist doch eine Farce, man hätte gleich nach 1945 diese Leute bestrafen müssen." Bejarano wird der Justiz das Versagen nie verzeihen, egal was jetzt noch in deutschen Gerichtssälen geschieht.
Für die zierliche Auschwitz-Überlebende kommt es darauf an, wie sich die ehemaligen SS-Leute vor Gericht präsentieren: Wer weiterhin der "schrecklichen Ideologie" anhänge, müsse "schwer bestraft werden". Wer Reue zeige, solle mit Milde rechnen dürfen.
Nur eines würde die kluge, quirlige Musikerin unerträglich finden: Freisprüche. "Symbolisch müssen sie auf jeden Fall verurteilt werden", sagt sie. "Denn sie waren dabei und haben mitgemacht, selbst wenn sie sich persönlich nichts zuschulden kommen ließen."
Doch so eine salomonische Lösung ist keine Option: In der deutschen Rechtsordnung sind symbolische Strafen nicht vorgesehen. Dort gibt es nur: schuldig oder nicht schuldig.
Eingeweihte rechnen damit, dass es am Ende allenfalls in zwei Fällen zu Gerichtsverfahren reichen könnte.
Sollten beide Greise dann noch verurteilt werden, stiege der Anteil der SS-Angehörigen aus Auschwitz, die in der Bundesrepublik schuldig gesprochen wurden, auf einen neuen Höchststand.
Auf 0,48 Prozent.
DER SPIEGEL 35/2014