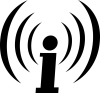„Der Völkermord in Ruanda 1994 sticht unter allen Episoden des einseitigen Massenmordes hervor, und etwas Ähnliches hat die Welt seither nicht mehr erlebt“, schreibt Steven Pinker in seiner monumentalen Studie „Gewalt. Eine neue Geschichte der Menschheit“.[1] Gerade weil die Vereinten Nationen dieser Tage vor einem neuerlichen Völkermord, diesmal in der Zentralafrikanischen Republik, warnen, gilt es, sich das Spezifische, aber vielleicht auch Exemplarische der Ereignisse vor zwanzig Jahren zu vergegenwärtigen.
Ab dem 6. April 1994 wurden in Ruanda innerhalb von 100 Tagen etwa eine Million Menschen ermordet. Dies war der gewaltigste Genozid in Afrika und der „schnellste“ Genozid in der Weltgeschichte. Doch der Massenmord an den Tutsi war keineswegs, wie es oft kolportiert wird, eine spontane Aktion oder ein afrikanischer Stammeskrieg, im Gegenteil: Der Völkermord war „das Ergebnis einer bewussten Entscheidung, getroffen von einer modernen Elite, die sich durch Verbreitung von Hass und Angst den Machterhalt zu sichern suchte“, so Alison Des Forges, die Historikerin des Genozids in Ruanda. „Diese kleine privilegierte Gruppe brachte zunächst die Mehrheit gegen die Minderheit auf, um der zunehmenden Opposition innerhalb Ruandas Herr zu werden.“[2] Im Gegensatz zum Genozid der Deutschen an den Juden gab es beim Genozid in Ruanda keine Klassifizierung der Opfer nach pseudowissenschaftlichen Kriterien oder eine langfristig geplante Deportation der Opfer an entfernte, geheime Orte – zur Vernichtung durch Arbeit oder zur sofortigen Ermordung.[3] Es gab auch keine ausgebildeten Spezialeinheiten zur Ergreifung, Bewachung und Ermordung der Opfer. Sondern in Ruanda wurden die Morde von einer Elite binnen weniger Monate geplant und von kurzfristig darauf vorbereiteten Milizen durchgeführt, teilweise unter indirekter Hilfe bzw. Duldung Frankreichs. Zudem fanden die Morde direkt dort statt, wo man die Opfer angetroffen hatte.
Diese schiere Explosion der Gewalt ist allerdings nur durch die Geschichte der beiden traditionellen Gruppierungen – Hutu und Tutsi – zu erklären. Diese entpuppen sich bei genauem Hinschauen als soziale und nicht – wie oft fälschlich behauptet – als ethnische Gemeinschaften.
Sozial gemachte Ethnien
In Ruanda – wie auch in Burundi – verlief die Gruppenzugehörigkeit der Menschen ursprünglich kaum entlang der Definition „Hutu“ oder „Tutsi“, sondern man gehörte eher einem von 18 regionalen Clans an. Innerhalb dieser Clans kam es dann zur sozialen Unterscheidung von Hutu, die eher vom Ackerbau, und Tutsi, die mehrheitlich von der Viehwirtschaft lebten. Fast überall auf der Welt kennt die Geschichte Konflikte zwischen Hirten und Bauern, so auch in Ruanda. Um ihr Vieh zu hüten, müssen die Hirten mobil sein und die Herden mit Waffen vor Viehdieben und Raubtieren schützen. Solange das Land dünn besiedelt war und die beiden Gruppen nebeneinander leben und ihre Produkte tauschen konnten, brachte das wenig Streit. Doch irgendwann richteten die mobilen, groß gewachsenen Hirten, sprich: die Tutsi, ein Tribut- und Abgabensystem ein, dass den kleineren Hutu Schutz vor äußeren Feinden gewährte. So entstand ein soziales Kastensystem, bei dem die Tutsi die Oberschicht stellten. Nur selten kam es zu gemischten Heiraten, weil die Kasten- oder Klassenschranken im Laufe der Jahrhunderte sehr dominant wurden. Erst ab dem 20. Jahrhundert konnte man vom Hutu zum Tutsi „aufsteigen“. Die Gesellschaft war jedoch nicht nur in ihrer Breite gespalten, sondern auch an der Spitze: Man kannte einen „Häuptling des Viehs“ und einen „Häuptling der Erde“.
Allerdings gibt es bis heute auch Gemeinsamkeiten zwischen Hutu und Tutsi: Etwa 90 Prozent der Ruander spricht die Bantusprache Kinyarwanda. Diese wird nur noch in Burundi und im Süden Ugandas sowie bei den ursprünglich von Ruanda in den Osten des Kongo eingewanderten Völkern verstanden. Auch unterschieden sich Hutu und Tutsi kaum in kultureller und religiöser Hinsicht.
Die Kategorien Hutu und Tutsi bezeichnen heute, nachdem sie sich von der Tradition der Bauern und Hirten zunehmend gelöst haben, vor allem soziale und ökonomische Zuschreibungen, die vom Vater auf die Kinder vererbt werden. Allerdings haben soziale Mobilität, Modernisierung und Verstädterung das alte gesellschaftliche Differenzierungssystem mehr und mehr durcheinandergewirbelt. So kennt – und kannte man stets – auch arme Tutsi und groß gewachsene Hutu. Neben den gemischten Ehen gab und gibt es bis heute zudem viele persönliche Kontakte zwischen den Menschen beider Gruppierungen, die auch während des Genozids nicht zerstört wurden: Selbst dessen planerischer Kopf, Oberst Théoneste Bagosora, und führende Mitglieder der Übergangsregierung „retteten das Leben ihnen nahestehender Tutsi – ein Beweis dafür, wie sehr die engen Bindungen zwischen Hutu und Tutsi selbst den hartnäckigsten Versuchen, sie zu zerstören, standhielten“.[4]
Das Ende der Kolonialzeit und der Beginn der Hutu-Diktatur
Der Völkermord in Ruanda ist – neben der Spaltung in Hutu und Tutsi – zudem nicht zu verstehen ohne die nachkoloniale Geschichte des Landes. 1959, drei Jahre vor der Unabhängigkeit Ruandas, kam es unter belgischer Aufsicht erstmals zu freien Wahlen. Dabei erhielten die Hutu-Parteien über 90 Prozent der Parlamentssitze. Die „Hutu-Power“ war geboren. Die belgischen Kolonialbehörden bevorzugten in der Folgezeit bei der Besetzung von Verwaltungsposten Angehörige der Hutu-Gruppen. Die lange Zeit privilegierten Tutsi hatten, da klar in der Minderheit, das Nachsehen.
Hinzu kam ein weiteres Spezifikum, auf das Mahmood Mamdani[5] aufmerksam macht: Ruanda (und Burundi) waren keine klassischen Kolonien mit einer dominierenden Oberschicht von weißen Siedlern, wie in den ehemaligen britischen Kolonien Kenia, Tansania, Rhodesien oder Südafrika. Bei vielen afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen spielte der Kampf gegen die Kolonialherren und europäische Siedler als den von außen kommenden Feind eine wichtige Rolle bei der Entwicklung einer gemeinsamen nationalen Identität. Anders in Ruanda, wo es kaum Europäer gab. Hier gerieten durch die „Hutu-Power“ die Tutsi in die Rolle der Weißen und wurden als nicht zum Lande gehörig betrachtet, sondern als Europäer mit schwarzer Hautfarbe angesehen – als Feinde im eigenen Land.[6] Bereits in den Jahren 1959 bis 1963 verloren über 20 000 Tutsi durch Gewalttaten ihr Leben. Schon damals wurden Stimmen laut, alle Tutsi zu töten oder des Landes zu verweisen.[7] All das zeigt: „Das Trauma in den Hutu-Tutsi-Beziehungen ist danach tief. Böses gebiert seither Böses. Hoffnungsvolle Versuche zur Vermeidung neuer Katastrophen waren vergeblich.“[8]
Nach der Unabhängigkeit im Jahre 1962 entwickelte sich das Land endgültig in eine autoritäre Hutu-Diktatur. Diese war allerdings nicht nur gegen Tutsi, sondern auch gegen oppositionelle Hutu gerichtet. Innenpolitisch kam es seit 1966 in Ruanda zu einer umfassenden „Hutuisierung“, speziell im Bildungswesen. Die durch ihre frühere Privilegierung in diesen Bereichen vielfach noch dominierenden Tutsi sollten durch Quotensysteme aus den Schulen und Hochschulen gedrängt werden.[9]
Immer wieder kam es auch zu Massakern an der Tutsi-Minderheit. Als Reaktion auf diese Gewalttaten folgten drei große Flüchtlingswellen der Tutsi ins Ausland: von 1959 bis 1961, von 1963 bis 1964 und 1973.
Zwischen 1991 und 1994 steigerte sich die Gewalt; nun kam es jedes Jahr zu gewaltsamen Übergriffen auf die Tutsi. Nach Schätzungen flohen mindestens 300 000, die meisten davon ins benachbarte Uganda. Deren Nachkommen wuchsen dort auf und erlernten nun Englisch als erste Fremdsprache, was die Spaltung auch sprachlich vertiefte. Mit der nächsten Generation entstand ein Potential von Kämpfern gegen die Hutu-Mehrheit in Ruanda. Vor allem die Jüngeren schlossen sich der „Ruandischen Patriotischen Front“ (RPF) an und unterstützten den späteren Präsidenten Ugandas, Yoweri Kaguta Museveni, im ugandischen Bürgerkrieg.
An der Staatsspitze Ruandas stand dagegen seit dem 7. Juli 1973, nach einem unblutigen Putsch, General Juvenal Habyarimana – bis zu seiner Ermordung am 6. April 1994. Immer wieder wurde er in seinen Regierungsjahren von militanten Hutus kritisiert, weil er zu „Tutsi-freundlich“ sei. Denn manchmal waren sogar ein oder zwei Tutsi als Minister in seinem Kabinett vertreten. Andererseits drängten die Tutsi auf mehr staatliche Teilhabe und auf die Rückkehr von Hunderttausenden aus dem Exil. Angehörige der Hutu-Power plädierten dagegen, so dass faktisch kein Plan für eine geordnete Rückkehr der Tutsi oder gar für eine nationale Versöhnung existierte.
Der Angriff der Tutsi-Rebellen und das französische Versagen
Am 1. Oktober 1990 eroberte eine im ugandischen Exil entstandene und von dort unterstützte Tutsi-Armee unter Führung von Paul Kagame Teile des Nordens von Ruanda. Formal gesehen handelte es sich um einen Bruch des Völkerrechts – durch den Angriff auf ein anderes Land. Auf diese Weise wollten die Invasoren die immer wieder von Massakern bedrohten und in Ruanda verbliebenen Tutsi schützen und eine Rückkehr in das Heimatland, sichere Lebensbedingungen wie auch eine Teilhabe an der politischen Macht erzwingen. Nur durch internationalen Druck, die Vermittlung der Vereinten Nationen und die Drohung, Finanzhilfen zu stoppen, kam es zu mehreren Waffenstillständen, die jedoch von beiden Seiten, also der Armee der Exil-Tutsi und der Hutu-dominierten Regierung in Ruanda, nicht eingehalten wurden. Keine Seite mochte nachgeben: Die Tutsi wollten zurück nach Ruanda, und die das Land dominierenden Hutu weigerten sich, die Macht zu teilen.
Frankreich spielte bei alledem eine wichtige und letztlich verhängnisvolle Rolle. Es unterstützte den ruandischen Hutu-Präsidenten Habyarimana militärisch – auch als längst klar war, worum es den Hutu tatsächlich ging –, und zwar aus außenpolitischen Machtinteressen, um seinen Einfluss auf die französischsprachigen Länder Afrikas zu erhalten oder gar auszubauen.
Eine Rückkehr von mehreren 100 000 Tutsi, vorwiegend aus Uganda, aber auch aus Burundi und Tansania, in das kleine Ruanda hätte bedeutet, dass man die Bestrafung der Verantwortlichen für frühere Massaker und Vertreibungen gefordert hätte. Auch hätten die Tutsi ihre enteigneten Häuser, Ländereien und Vieh wiederhaben wollen. Der Bevölkerungsdruck wäre noch mehr angestiegen. Zudem verbanden speziell die Älteren mit der möglichen Rückkehr der Tutsi auch noch bittere Erfahrungen aus den kolonialen Zeiten der Tutsi-Herrschaft.
Vor allem die herrschende Hutu-Elite in Politik und Wirtschaft fürchtete um ihre Privilegien und lehnte die verkündeten Kompromisse ihres Präsidenten ab. Dieser hatte für die Zukunft ein Mehrparteiensystem vereinbart; doch faktisch blockierten der Präsident und seine politischen Vertrauten die angekündigte Demokratisierung.
Ein Grund dafür: Die nachkommende Tutsi-Generation im Exil galt als radikal. Insgesamt war die zukünftige Lage also höchst unsicher – vor allem auch deshalb, weil die UN nur ein „sanftes Mandat“ für die Umsetzung dieser Rückkehr-Vereinbarungen beschlossen hatte. Das bedeutet, dass seitens der UNO keine kampfbereiten Truppen eingesetzt werden sollten, um – für den Fall der Fälle – gewaltsam Frieden herzustellen.
Obwohl die RPF-Rebellenarmee Ende Oktober 1990 geschlagen wurde, konnte Paul Kagame seine Truppe sukzessive vergrößern und immer größere Landesteile in der Nähe der ugandischen Grenze besetzen. Dies hatte gewaltige innerruandische Flüchtlingsströme zur Folge. All das zwang die ruandische Regierung schließlich zu Friedensverhandlungen, die zwischen August 1992 und August 1993 in Arusha stattfanden und zu insgesamt vier Abkommen führten, darunter am 4. August 1993 der Friedensvertrag von Arusha. Darin wurden ein Waffenstillstand und die Demobilisierung der Armeen vereinbart sowie die Bildung einer Übergangsregierung eingeleitet.
Die Vorbereitungen zum Genozid
Angesichts der drohenden Rückkehr vieler Tutsi hatten sich in Ruanda militante Hutu-Gruppen gebildet, die die Arusha-Vereinbarungen in Frage stellten und Druck auf die herrschenden Politiker ausübten. Präsident Habyarimana und seine Freunde gehörten dem Clan der Akuzu („Kleines Haus“) an, der damals die dominierende politische Elite Ruandas stellte. Nach Ansicht von Gérard Prunier handelte es sich bei der Partei des Präsidenten Habyarimana um eine totalitäre Partei: „Jeder Ruander musste Mitglied sein, einschließlich der Babys und alten Leute. Alle Bürgermeister und Präfekten wurden aus dem Kreis der Partei-Kader ausgewählt.“[10]
Nach der Ideologie des Führungsclans galten allein die Hutu als „wahre Bauern“. Da die Landknappheit und der sinkende Kaffeepreis die Loyalität der Bauernschaft zum Regime schwinden ließen, sollten – um die Loyalität der Hutu wiederzugewinnen und in Ruanda eine echte „Bauerngesellschaft“ zu verwirklichen – alle Tutsi getötet werden.[11]
Die Gruppe um den Präsidenten unterstützte die Massenbewegung „Hutu-Power“ sowie deren Miliz Interahamwe („Die, die zusammenhalten“). In deren örtlichen Gruppen wurden etwa 30 000 vorwiegend jüngere und ärmere Leute regelrecht zum Morden ausgebildet. Anfangs wurde noch mit Holzgewehren geübt, doch dann kamen Tausende von Macheten aus Übersee. Da nur wenige der Milizangehörigen im Besitz von Feuerwaffen waren und eine halbe Million Pistolen und Gewehre schlicht zu teuer gewesen wären, besorgten die Drahtzieher des Genozids schon ein Jahr vorher, ab Januar 1993, Macheten, aber auch Hacken und Sicheln. Weil die in Ruanda zu beschaffenden Macheten nicht ausreichten, wurden mehr als eine halbe Million aus Großbritannien importiert. Diese hatten zusammengenommen einen Wert von mehr als einer halben Million US-Dollar.[12]
Die Massenmedien als Brandbeschleuniger
Auch die Massenmedien trugen erheblich zur Radikalisierung bei. Über zwanzig Zeitungen und Magazine wurden für die Hasspropaganda der Regierung finanziell unterstützt. Die 1990 gegründete Zeitschrift „Kangura“ schrieb im Januar 1994: „Die Tutsi-Kakerlaken sollten wissen, was passiert, dann werden sie verschwinden.“[13] In den ins Englische übersetzten Texten aus dieser Zeit ist auch häufig von „the final solution“ die Rede – also der wörtlichen Übersetzung von „Endlösung“.
Der Rundfunk begann schon im März 1992 von einer „Tutsi-Verschwörung“ gegen die Hutu zu sprechen. Im Rundfunk war zu hören: „Etwas Großes wird passieren.“ Im selben Jahr rief der erste führende Hutu-Politiker, Leon Mugesera, in einer Rede zum Krieg gegen die „Tutsi-Kakerlaken“ und zum Mord an den Tutsi auf. Im August 1993 entstand auch der erste Privatsender des Landes, „Radio Television Libre des Mille Collines“ (RTLMC). Finanziert von Unternehmern, gehörte er zur Gruppe um den Präsidenten und wirkte an der Hetze mit. (Ein Hauptverantwortlicher des Genozids, Oberst Bagosora, war ein Teilhaber.) Ab Anfang 1994 gestalteten sich die Sendungen von RTLMC immer aggressiver.
Ähnlich wie bei der antisemitischen Nazipropaganda wurden die Gegner mit Ungeziefer gleichgesetzt: Die Tutsi seien das Unglück Ruandas; sie wollten die alte Fronherrschaft wieder errichten und die Hutu hätten ihnen wieder zu dienen. Deshalb müssten die Inyenzi (Schaben, Kakerlaken) vernichtet werden. Zur Propaganda gehörte stets auch der Neidfaktor: Alle Tutsi wurden als Reiche dargestellt. Man nannte auch Namen und Wohnorte von Tutsi sowie oppositionellen Hutu, die zu „eliminieren“ seien. Auch hier sind die Parallelen zur antisemitischen Vernichtungspropaganda des NS-Regimes deutlich.[14]
Von den Hutu-Radikalen kam schließlich die kaum noch verschlüsselte Aufforderung über die Medien an die örtlichen Anführer, „Die Arbeit zu tun“, „Die großen Bäume zu fällen“, „Die Werkzeuge“ zu benutzen. Damit war gemeint, die führenden Tutsi sowie oppositionelle Hutu mit den Macheten zu töten. Nach dem Beginn des Massakers erfolgte der Befehl, nun auch das „Unterholz zu reinigen“, also die noch lebenden Tutsi zu ermorden.
Präsident Habyarimana hatte da seinen Machtapparat längst nicht mehr im Griff. Er befand sich in der Zwickmühle zwischen der radikalen Hutu-Power, die die Tutsi endgültig zu vernichten trachtete, sowie den internationalen Geldgebern, die dem Land nur für Frieden und Kompromisse weitere Mittel zur Verfügung stellen wollten.
Kurzum: Alle Vorbereitungen zum Massenmord hatten schon lange vor dem 6. April 1994 begonnen. „Die meisten Forscher, die sich mit dem Völkermord in Ruanda beschäftigt haben, vertreten die Auffassung, dass der Genozid zwischen November 1991 und August 1992 geplant worden sei“, stellt Philip Verwimp fest.[15] Es fehlte nur noch ein Anlass für seinen Ausbruch.
Der Abend des 6. April 1994 und seine Folgen
Dieser Anlass kam am Abend des 6. April 1994. Gegen 20.30 Uhr befand sich der ruandische Präsident zusammen mit seinem burundischen Amtskollegen Cyprien Ntaryamira an Bord einer ruandischen Regierungsmaschine im Anflug auf den Flughafen von Kigali. Plötzlich gingen, entgegen üblicher Praxis bei nächtlichen Landungen, die Lichter neben der Landebahn aus. Auf das Flugzeug wurden zwei russische SAM-Raketen abgefeuert. Eine traf und der Jet stürzte in den Garten des Präsidentenpalastes. Viele Jahre lang hat man die Tutsi verdächtigt, dafür verantwortlich gewesen zu sein. Erst Jahre später kam es zu gründlichen französischen Untersuchungen in Ruanda. Der im Januar 2012 veröffentlichte Bericht des Richters Marc Trevidic zeigt, dass die Rakete unmöglich von einer Tutsi-Stellung in der Nähe der Hauptstadt abgeschossen worden sein konnte, sondern von Hutu-Truppen abgefeuert wurde. Laut einem früheren Untersuchungsbericht einer ruandischen Kommission wurde der Präsident von abtrünnigen Soldaten der eigenen Truppen getötet.[16]
Und das Verhängnis nahm seinen Lauf: Schon kurz nach dem Abschuss der Maschine waren im Radio Aufrufe zu hören, die Tutsi zu ermorden, weil diese für den Tod des Präsidenten verantwortlich seien. Sehr schnell wurden Straßensperren errichtet, Fußgänger, Zweiradfahrer und Insassen von Fahrzeugen kontrolliert. Wer ein „Tutsi“ im Ausweis stehen hatte oder keinen Ausweis zeigen konnte oder wollte, wurde ermordet. Hutu, die gegen dieses Vorgehen protestierten, ereilte teilweise das gleiche Schicksal.
In den Dörfern wusste man oft, wer zu welcher „Kategorie“ gehörte. Tagsüber markierte man die Häuser (wie bei den Pogromen in Indonesien gegen die Chinesen und sogenannte Kommunisten), um dann in der Dunkelheit über die Nachbarn herzufallen.
Schon Wochen vorher hatten die Rädelsführer Tausende von Tutsi sowie oppositionelle Hutu in Listen erfasst. Diese wurden noch in der Nacht vom 6. zum 7. April 1994 gezielt aufgesucht und umgebracht. Am nächsten Tag ermordeten die Milizen die verfassungsmäßige Stellvertreterin des getöteten Präsidenten, die Ministerpräsidentin Agathe Uwiligiyimana, mit ihrem Ehemann. Beide waren gemäßigte Hutu und standen ganz oben auf der Todesliste. Nach ihrer Ermordung wurde eine von radikalen Hutus dominierte Übergangsregierung ernannt. Diese gab den Befehl zum Massenmord – deklariert als „Kampf gegen die Tutsi, welche die Hutu vernichten wollen“ – nach unten weiter an Präfekten, Bürgermeister und Dorfchefs.
Parallel dazu agierten die mit der Hutu-Partei verbundenen Milizen; auch Teile des Militärs waren zum Töten abgestellt. Häuser und ganze Dörfer wurden gezielt überfallen. Es kam zu tausendfachen Vergewaltigungen und Verstümmelungen. Nachbarn beglichen alte „Rechnungen“. Eigentum und Grundbesitz der Getöteten waren schnell verteilt. Die Anstifter versorgten die Milizen abends mit dem begehrten Primus-Bier. Sie betranken sich und gingen dann nach „getaner Arbeit“ nach Hause, um am nächsten Tag weiter zu „arbeiten“. Polizei und Armee schauten meistens zu, teilweise beteiligten sie sich; nur manchmal verhinderten sie Schlimmeres.
Ganz „normale“ Mörder?
Von Alison Des Forges stammt folgende Einschätzung der Ereignisse: „Der Völkermord in Ruanda ist mit nichts vergleichbar, was die Art angeht, wie seine Organisatoren die Bevölkerung beteiligten. Weit entfernt davon, ihr Vorhaben zu verheimlichen, taten sie ihr Ziel in Liedern und durch Parolen, über die Presse und im Radio kund: Es galt, die Angehörigen der Tutsi-Minderheit umzubringen. Sie riefen die Hutu dazu auf, sich der Mordkampagne anzuschließen, und hämmerten ihnen ein, dass dies alle anginge. Sie begingen die schlimmsten Massaker am helllichten Tag und machten sich in manchen Gemeinden noch nicht einmal die Mühe, die Toten zu verstecken.“[17]
Es muss sich um eine ungeheure, rauschartige, durch Verführung und Drohung bewirkte Entladung von Hass gehandelt haben. Wahrscheinlich sind auch massive individuelle und kollektive Kränkungen im Spiel gewesen. Aber oft haben die Täter Menschen umgebracht, die sie vorher gar nicht gekannt, die ihnen nichts getan hatten. Also können die realen oder vermeintlichen Kränkungen nicht von den Opfern herrühren.
Die Mörder, auch Génozidaires genannt, stammten aus verschiedenen Gruppen: der Eliteeinheit der Präsidentengarde, Angehörigen der Armee, den Milizen, Opfern der Exil-Tutsi-Armee, Hutu-Flüchtlingen aus Burundi und vielen einfachen Hutu, die zu Gewalttaten verführt oder gezwungen wurden. Vor allem ärmere Hutu mussten bei einer Rückkehr von Hunderttausenden von Tutsi befürchten, ihre – wie auch immer erworbenen – Privilegien und Besitztümer zu verlieren.
Die Angaben zur Anzahl der Génozidaires schwanken von zwischen einigen Zehntausend bis zu mehreren Millionen Hutu. Neuere Schätzungen gehen davon aus, dass etwa sieben bis acht Prozent der damaligen Hutu-Bevölkerung mindestens einen Mord begangen haben.[18] Im Jahre 2000 befanden sich noch über 100 000 Menschen wegen Gewaltdelikten in Haft.
Die Gewalt selbst kannte keine Grenzen. Manchen Tutsi wurden etwa die Beine abgehackt, um sie „kürzer“ zu machen. Die Leichen warf man in die Flüsse, damit sie „zurück“ nach Äthiopien oder Ägypten „schwimmen“ sollten. Ende Juni 1994 wurden allein im Viktoriasee über 10 000 Leichen geborgen. Anfangs versuchten die Mörder nicht einmal, ihre Schandtaten zu verbergen. Erst später, als die Befreier immer näher rückten, begann man damit, die vielen Toten maschinell unter die Erde zu pflügen und mit Kalk abzudecken. „Kein Zeuge darf überleben“, lautete eine Parole – so auch der Titel des bewegenden Buches von Alison Des Forges.
Schon als der Genozid begann, standen Truppen der Exil-Tutsis an verschiedenen Stellen Ruandas, auch in der Nähe von Kigali.[19] Mit ihren etwa 20 000 Soldaten war diese Armee den Milizen, uniformierten Mördern und der ruandischen Armee zwar zahlenmäßig unterlegen, aber besser ausgebildet und höher motiviert. Auf ihrem Vormarsch rettete sie Tausende von Tutsi und gefährdete Hutu. Allerdings wurden viele der Befreier ihrerseits auch zu Mördern. Alison Des Forges schätzt, dass die Exil-Armee zwischen April und August 1994 etwa 25 000 bis 45 000 Hutu umgebracht hat – auch in Gebieten, wo zuvor wenige oder keine Tutsi ermordet worden waren.[20]
Die Gesamtzahl der Opfer des Genozids wird unterschiedlich eingeschätzt. Manche Quellen nennen mindestens eine halbe Million; häufig wurde die Zahl 800 000 erwähnt. Die offiziellen ruandischen Stellen im „Kigali Genocide Memorial Centre“ sprechen jedoch von über einer Million Toten, von denen 950 000 inzwischen namentlich identifiziert sind. Am Ende waren fast dreiviertel der in Ruanda lebenden Tutsi-Minderheit ausgelöscht, etwa 50 000 der Opfer sollen der Hutu-Gruppe angehört haben.
Das Versagen der internationalen Gemeinschaft
Die Durchführung des Genozids, aber auch seine Vorbereitungen blieben kritischen Beobachtern in und außerhalb Ruandas daher keineswegs verborgen. „Wir Experten und internationalen Vertreter vor Ort haben seit 1992 ziemlich eindeutige Informationen in unsere Heimatländer und Botschaften geschickt – über Trainingscamps der Milizen, Verteilung von Waffen, kursierende Namenslisten von Tutsi und Oppositionspolitikern, über Morde und Gewalttaten, über die Hasspropaganda in Radio und Presse“, so der deutsche Ruanda-Experte Helmut Asche.[21] Aber in den Machtzentren der Welt, wie auch bei der UNO, nahm man diese Warnungen nicht ernst. Als die Gewalthandlungen begannen, bemühte man sich, den Begriff „Genozid“ zu vermeiden, und sprach lediglich von „Stammeskriegen“ – um keine Pflicht zur Intervention auszulösen.
Dabei war allen Experten schnell klar, dass es zu massiven Gewalttaten kommen würde. Schließlich hatten die Geheimdienste längst berichtet, was bereits alles vorgefallen war. Die Reaktionen waren denn auch eindeutig – allerdings nur zugunsten der Ausländer: „Insgesamt wurden 3900 Menschen aus 22 Ländern aus Ruanda evakuiert. In Kigali schlossen alle Botschaften mit Ausnahme der chinesischen ihre Tore. Die Franzosen reisten Hals über Kopf ab. In der französischen Botschaft blieb ein ganzes Zimmer voll mit geschreddertem Papier zurück – erfolgreich vernichtete Dokumente einer beschämenden Episode.“[22]
Weshalb aber griffen die UNO, aber auch die USA und europäische Länder nicht ein?
Ein entscheidender Grund dafür war die gescheiterte UN-Mission während des Bürgerkrieges in Somalia. Im Oktober 1993 wurden dort 18 US-Soldaten getötet. Die Bilder gingen um die Welt – als Sinnbild des Scheiterns der letzten verbliebenen Supermacht. Seitdem hielt man sich bei weiteren militärischen Einsätzen in Afrika sehr zurück.
Erst am 1. Juli 1994 entschied eine UN-Resolution, zu untersuchen, ob „mögliche Völkermordhandlungen“ in Ruanda vorgekommen seien. Da war das Morden allerdings schon beendet. Später kam es zu Entschuldigungen durch die UN-Führung von Butros Butros-Gali und Kofi Annan sowie dem damaligen US-amerikanischen Präsidenten Bill Clinton.
Der militärische Leiter der UN-Truppen, Roméo Dallaire, warf Kofi Annan allerdings eine Mitschuld am Völkermord vor. Kofi Annan verteidigte sich in einem Interview mit folgenden Worten: „Der Grund für das Scheitern von Ruanda war fehlender politischer Wille.“[23] In der Tat.
Genozid unter den Augen der Welt
Bereits seit dem 17. August 1993 war ein kleines UN-Kontingent aus verschiedenen Ländern, zuerst etwa 80 Personen stark, in Ruanda stationiert. Die Soldaten hatten jedoch nur einen Beobachterstatus, also kein „robustes Mandat“, durften also nicht aktiv in das Kampfgeschehen eingreifen. Waffengebrauch war nur zur Eigensicherung erlaubt. Kommandeur der kleinen UN-Truppe war der kanadische General Roméo Dallaire. Später hatte er zeitweise etwa 2700 Soldaten zur Verfügung, dann wieder weniger. Mit einigen hundert Militärs sollte Dallaire eine etwa 120 mal 20 Kilometer große entmilitarisierte Zone überwachen. Dallaire wollte die Waffenlager der Hutu-Milizen beschlagnahmen. Das war ihm verboten worden. Die UN-Zentrale ging auch nicht einmal auf seinen Vorschlag ein, den Hetzsender RTLMC unschädlich zu machen. Das hätte man mit einem gezielten Bombenangriff tun können.
Nach Aussage von General Dallaire wären 5000 gut ausgebildete Soldaten ausreichend gewesen, um den Genozid zu verhindern.[24] Dallaire selbst kam mit einer „posttraumatischen Belastungsstörung“ zurück nach Kanada. Er unternahm zwei Suizid-Versuche und wurde aus der Armee entlassen. Neben vielen Therapiestunden retteten ihn wahrscheinlich auch seine Öffentlichkeitsarbeit, ein Dokumentarfilm und sein Buch „Handschlag mit dem Teufel. Die Mitschuld der Weltgemeinschaft am Völkermord in Ruanda“.[25] Seine vergeblichen Versuche, mit völlig unzulänglichen Mitteln Menschenleben zu retten, wurden eindrucksvoll im Film „Hotel Ruanda“ dargestellt.
Erst am 17. Mai 1994 beschloss der UN-Sicherheitsrat eine zweite Hilfsaktion für Ruanda. UNAMIR II wurde mit einem „robusten Mandat“ ausgestattet. Mehr als 5500 Soldaten sollten nun auch Zivilisten beschützen dürfen. Aber für die Mehrheit der Tutsi kam dies zu spät.
Am 19. Juli 1994 wurde eine neue Regierung in Kigali vereidigt. Ruandas neuer Präsident wurde Pasteur Bizimungu – ein Hutu, der vom gerade besiegten Hutu-Regime als Oppositioneller verhaftet und gefoltert worden war. Paul Kagame, der Anführer der Exil-Tutsi, wurde zunächst Vizepräsident; seit 2000 ist er Staatspräsident von Ruanda. Doch von einer Bearbeitung – gar „Bewältigung“ – des Genozids kann bis heute allenfalls in Ansätzen die Rede sein. Zwar sind die Begriffe „Hutu“ und „Tutsi“ in Ruanda heute verboten; doch im Land leben Millionen von traumatisierten Menschen – längst auch in der zweiten Generation.
Von Nando Belardi
[1] Steven Pinker, Gewalt. Eine neue Geschichte der Menschheit, Frankfurt a. M. 2011, S. 506.
[2] Alison Des Forges, Kein Zeuge darf überleben. Der Genozid in Ruanda, Hamburg 2002, S. 16.
[3] Allerdings knüpften die Ruander, trotz der großen kulturellen Unterschiede, rhetorisch an den Holocaust an, indem sie auch von „Endlösung“ sprachen. In „Ruanda. Zwanzig Jahre nach dem Genozid. Die Destabilisierung einer Region und was Deutschland damit zu tun hat“ (E-Book bei Amazon/Kindle, 2014) gehe ich genauer auf diese Zusammenhänge ein.
[4] Des Forges, a.a.O., S. 29.
[5] Mahmood Mamdani, When Victims become Killers, New York 2001, S. 103 ff.
[6] Ebd., S. 88.
[7] Ebd., S. 130.
[8] Helmut Strizek, Ruanda und Burundi von der Unabhängigkeit zum Staatenzerfall, München 1996, S. 169.
[9] Mamdani, a.a.O., S. 136.
[10] Gérard Prunier, The Rwanda Crisis. History of a Genocide, Kampala und London 1999, S. 76.
[11] Philip Verwimp, Bauernideologie und Völkermord in Ruanda, in: „Zeitschrift für Genozidforschung“, 1-2/2001, S. 47-80, hier: S. 79.
[12] Des Forges, a.a.O., S. 20, S. 164 ff.
[13] Mamdani, a.a.O., S. 212.
[14] Im Dezember 2011 wurde „Hate Radio“ aufgeführt, ein vielbeachtetes Theaterstück des Schweizer Regisseurs Milo Rau, das im April 2013 auch als Hörspiel gesendet wurde. Mit einem Mix von Musik, Sport und Hasstiraden wird in authentischer Weise dargestellt, wie der ruandische Hass-Sender arbeitete. Soeben ist dazu auch das gleichnamige Buch von Milo Rau erschienen, das – neben dem kompletten Stücktext – Täter, Opfer und Augenzeugen zu Wort kommen lässt (Verbrecher Verlag Berlin, 2014).
[15] Vgl. Verwimp, a.a.O., S. 49.
[16] Vgl. www.zeit.de, 11.1.2012.
[17] Alison Des Forges, a.a.O., S. 902.
[18] Scott Straus, The Order of Genocide, Race, Power, and War in Rwanda, Ithaca 2006, S. 117.
[19] Genau genommen rekrutierte sich die Armee nicht allein aus Tutsi-Flüchtlingen und deren in Uganda aufgewachsenen Nachkommen, sondern es gehörten auch Hutu dazu, die in Opposition zum Regime in Kigali standen.
[20] Des Forges, a.a.O., S. 826 und 851. Wahrscheinlich hat es auch Tausende von „Zufallsopfern“ gegeben.
[21] Vgl. www.spiegel.de, 7.4.2004.
[22] Linda Melvern, Ruanda. Der Völkermord und die Beteiligung der westlichen Welt, München 2004, S. 223.
[23] Vgl. „Der Spiegel“, 11/2013.
[24] Des Forges, a.a.O., S. 42.
[25] Roméo Dallaire, Handschlag mit dem Teufel. Die Mitschuld der Weltgemeinschaft am Völkermord in Ruanda, Frankfurt a. M. 2003.