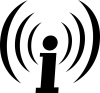Die Polizeilobby plärrt wie keine andere: Polizisten würden angegriffen, bespuckt, beleidigt. Doch was ist an den Behauptungen wirklich dran? Und wer kämpft hier eigentlich gegen wen
Morgens las der Professor im „Abendblatt“: „Hamburger Polizisten fordern mehr Respekt“, groß auf Seite eins. Immer häufiger würden Polizisten angeschrien und bespuckt, immer öfter müssten sie sich im Einsatz rechtfertigen. Auf Seite zwei barmte der Chefredakteur: „Mehr Anstand, bitte“. Und auf der Acht klagte ein 26 Jahre alter Polizeimeister: Auf dem Kiez gehöre es zum Alltag, beschimpft zu werden. Wie sich das anfühle, habe er in der Ausbildung nicht gelernt. Das lasse ihn nicht kalt.
Der Professor las die drei Artikel. Und ärgerte sich. Er lehrt an der Polizeihochschule in Hamburg und heißt Rafael Behr. Behr meldete sich bei der Journalistin, die über die Polizei geschrieben hatte. Zwei Wochen später erschien ein neuer Artikel, Überschrift: „Hamburger Kriminologe: Die Polizei jammert zu viel“. Das war es, was Behr so geärgert hatte. Das Jammern.
Woran merkt man, dass einer nicht leidet, sondern jammert? Ganz einfach: Man muss es ihm nur auf den Kopf zusagen. Du jammerst! Die Reaktion ist immer die gleiche. Wut. Am selben Tag noch, an dem der neue Artikel in der Zeitung stand, jagten alle drei Polizistenlobbys (zwei von ihnen nennen sich „Gewerkschaften“, als seien Polizisten nicht etwa beamtete, unkündbare Staatsdiener mit Pensionsanspruch, sondern Arbeiter oder Angestellte, die ihre Löhne aushandeln müssen und jederzeit den Job verlieren können) - die Polizistenlobbys also jagten schnurstracks Pressemitteilungen über ihre Verteiler.
Männer am Rande des Nervenzusammenbruchs
Einen „Fall akuter Profilneurose“ diagnostizierte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und bot an, „dem Herrn Professor auf dem Weg zurück in die Realität behilflich zu sein“. „Frech“ nannte der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) den Jammervorwurf. Eine Entschuldigung sei umgehend fällig, und für „schwer denkbar“ halte man, dass Behr in Zukunft noch den Polizeinachwuchs unterrichte.
“Mit fassungslosem Entsetzen“ habe man die Äußerungen des Professors gelesen, heulte die Deutsche Polizei-Gewerkschaft (DPolG), als gelte es, den ersten Platz bei einem Heulbojenwettbewerb zu erringen. Behrs Worte seien „ehrverletzend, diffamierend und verleumderisch“, das Menschenbild des Wissenschaftlers erscheine „bemerkenswert“. Behr sei „offensichtlich fehl am Platze“. Der Hamburger Landesvorsitzende des Verbands gab kund: „Ich halte die Einleitung dienstrechtlicher Maßnahmen, bis hin zur Ablösung, für zwingend erforderlich.“ Männer am Rande des Nervenzusammenbruchs.
Jenseits der Lobby sah man die Sache nüchterner. Polizeiwissenschaftler solidarisierten sich mit dem Professor. Er solle als Nestbeschmutzer stigmatisiert werden, bloggte einer von der Uni Hamburg. Behrs These fanden die Kriminologen dort so interessant, dass sie den Zeitungsartikel sofort am Schwarzen Brett aufhängten.
Kollegen kämpfen auch gegen Kollegen
Behr gilt als einer der führenden Polizeiwissenschaftler in Deutschland. Davor war er außerdem fünfzehn Jahre lang Polizeibeamter, fuhr Streife. Seit 2008 ist er Professor. Kollegen beschreiben ihn als „ruhigen Charakter, mit dem man gut reden kann“. Dass man ihm den „Weg zurück in die Realität“ weisen müsste, hat außer den Gewerkschaften noch niemand gefordert. Vielleicht, weil Behrs Realität für niemanden so unangenehm ist wie für sie.
Denn Behr bestreitet, was die Gewerkschaften seit Jahrzehnten predigen. Erstens: Die Gewalt gegen Polizisten wird immer schlimmer. Zweitens: Die finanzielle Not der Polizei wird immer größer. Alles ein großes, heulendes Elend. Behr versteht, dass Polizisten Sorgen haben. Hat ja schließlich jeder. Was ihn ärgert, ist das permanente Jammern der Gewerkschaften. Wer dauernd alle Welt auf seine Opferrolle hinweise, würde eben wie ein Opfer behandelt. Niemand will sich einem Loser unterordnen, erst recht nicht, wenn der dafür bezahlt wird, stark zu sein. „Instrumentell“ nennt Behr das Gegreine.
Nach dem Motto: Wer am lautesten lärmt, wird von den meisten gehört. Und Aufmerksamkeit bringt Geld. „Kollegen kämpfen für Kollegen“, wirbt eine Gewerkschaft. Womit keiner wirbt: Kollegen kämpfen auch gegen Kollegen, um Mitglieder. 170.000 hat die GdP, halb so viele die DPolG. Beide wollen mehr. Dafür müssen sie lärmen.
Als Rainer Wendt vor sechs Jahren Bundesvorsitzender der DPolG wurde, lautete einer seiner Dienstaufträge: Medienpräsenz erhöhen. Denn die DPolG war ja immer nur die Nummer zwei, sie ist es bis heute: später gegründet als die GdP, und weniger Mitglieder. Wendt will möglichst oft in die Medien. Er weiß, dass das Aufmerksamkeit bringt von Politikern, die etwas für ihn tun sollen, und von Polizisten. Gute Werbung.
Wenn Wendt braungebrannt aus dem Marokko-Urlaub zurück in sein Büro kommt, schmeißt er gleich am ersten Tag die Werbemaschine wieder an. Alle sollen wissen: Der Wendt ist zurück. Darum ruft er zum Beispiel einen Journalisten an und sagt: „Soll’n wir mal ’ne schöne Geschichte machen?“ Wendt fordert dann höhere Strafen für die Bösen oder mehr Personal für die Guten, und der Journalist hat eine Exklusiv-Story: „Und hinterher sind alle zufrieden.“ Fernsehjournalisten loben Wendt, weil er polemischer ist als der GdP-Chef. Der muss sehen, dass er trotzdem gehört wird.
Wendt sagt, dass der Respekt vor der Polizei bei vielen Deutschen weg sei, weil sogar Politiker das Handeln der Polizei öffentlich in Frage stellten. Deswegen soll niemand lautstark die Polizei kritisieren. Der Hamburger Professor aber hat das getan. Horror für die Gewerkschaften. Behrs Vorwurf macht ihnen das Geschäft kaputt.
Je größer die Gefahr, desto sicherer die Privilegien
Fast niemand in der Polizei traut sich, Tacheles zu reden. Kritik wird als Schwächung betrachtet, Kritik aus den eigenen Reihen gar als Hochverrat. Wenn sie dann noch auf das Jammern zielt, geht es schlimmer nicht mehr. Denn mal angenommen, es wäre alles gar nicht sooo furchtbar: Dann könnte ja bei der Polizei gespart werden. Die zwei wichtigsten finanziellen Privilegien von Polizisten sind aus der Gefährlichkeit ihres Berufs hergeleitet: die Polizeizulage und die freie Heilfürsorge. Die Zulage ist eine Pauschale, die jeder Polizist bekommt, der eine Waffe tragen darf.
Und freie Heilfürsorge bedeutet: kostenlose Krankenversicherung. Je größer die Gefahr, desto sicherer die Privilegien. Dafür wird auch schon mal bei der Beweisführung getrickst. Vor einem Jahr rief im Polizeimagazin „Streife“ der Inspekteur der Polizei von Nordrhein-Westfalen alle Kollegen auf, bei einer Befragung mitzumachen, Thema: „Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte“. Im Editorial nahm er das Ergebnis allerdings gleich mal vorweg: „Die Hemmschwelle zur Gewaltanwendung ist gesunken.“ Den „sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen“ bescheinigte er vorsorglich schon mal ein „professionelles und deeskalierendes Einschreiten“.
Der Erfahrungsbericht eines Polizeihauptkommissars gab dann noch mal die Richtung vor: „Bei uns verfestigt sich bereits der Eindruck: Die Gewaltbereitschaft gegenüber Polizeibeamtinnen und -beamten ist alarmierend hoch.“ Und für die ganz Doofen die Zusammenfassung: „eine neue Qualität und Intensität der Gewalt“. Dieses „Phänomen“ solle die Studie „darstellen“. Ein anderes „Phänomen“ zeigt allerdings der Lagebericht des Landeskriminalamtes von Nordrhein-Westfalen über das Jahr 2010. Bei „höchstens“ 0,1 Prozent aller Einsätze kam es zu Gewaltandrohung, versuchter Gewalt oder Gewalt gegen Polizisten. Schwer verletzt wurden bei insgesamt 4.040.768 Einsätzen - 13 Polizisten.
Keine Prüfung, lieber gleich mehr Geld
Die Freude an Fakten dieser Art hält sich bei den Gewerkschaften in Grenzen. Als der Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, Christian Pfeiffer, vor drei Jahren mit einer bundesweit angelegten Studie über Gewalt gegen Polizisten begann, merkte er bald, was Sache war. Er wollte im Auftrag der Innenministerkonferenz die teilnehmenden Polizisten sorgfältig befragen, in alle Richtungen. Offenbar eine Zumutung. Es gab Fragen zur Selbsteinschätzung, nach dem Herkunftsland der Eltern und danach, wie man Wut verarbeite. Diese Fragen gefielen der GdP nicht, die die Studie mitfinanzierte.
Doch richtig Ärger gab es erst, als DPolG-Chef Wendt sich einschaltete. Selbst die von den Forschern entschärfte Version des Fragebogens ähnele „mehr einer Täter-Analyse als einer Opfer-Analyse“, klagte die DPolG in einem Rundschreiben. Die DPolG Südhessen schlug vor, dass doch lieber die Polizei selbst - in Form der Hochschule der Polizei - die Studie über Gewalt gegen sich durchführen solle. Die DPolG Westhessen fand, dass „statt einer solchen Studie die Schutzausstattung der Polizeibeamtinnen und -beamten sowie eine Aufstockung des Personals Priorität haben sollte“.
Keine Prüfung, lieber gleich mehr Geld. Der Druck zeigte Wirkung, sechs Bundesländer stiegen aus der Studie aus. Unter ihnen Nordrhein-Westfalen, das dann für seine eigene Studie wie beschrieben in der „Streife“ warb. Es waren aber nicht nur die Fragen, die die Gewerkschaftler erzürnten. In der DPolG war man auch sauer darüber, dass nur die Konkurrenz bei der Studie mitreden durfte. Bei einem Versöhnungsfrühstück mit Wendt, heißt es, habe der Wissenschaftler Besserung gelobt. Er brachte seine Studie 2011 zu Ende.
Ergebnis: Die Zahl der gemeldeten Gewalttaten gegen Polizisten ist zwischen 2005 und 2009 gestiegen. Bloß heißt das noch nicht, dass mehr Polizisten angegriffen und schlimmer verletzt wurden als früher. “Kollegen machen heute eher als in der Vergangenheit Anzeigen wegen kleinerer Konflikte“, sagt Udo Behrendes. Er ist Leiter des Leitungsstabes im Polizeipräsidium Köln. Seit Jahren schon beschäftigt er sich mit Gewalt gegen - und durch - Polizisten. Mit der einseitigen Darstellung durch die Gewerkschaften ist er daher nicht einverstanden. Die Sensibilität für Gewalt sei eben innerhalb und außerhalb der Polizei gestiegen.
Bürger zeigten inzwischen polizeiliche Gewalt oder das, was sie dafür hielten, eher an. Deshalb schrieben wiederum viele Polizisten schon vorsorglich Anzeigen, um den Bürgern zuvorzukommen. Wenn ein Polizist als Verletzung eine verstauchte Hand melde, könne es auch sein, dass sie verstaucht sei, weil er selbst jemanden körperlich angegangen sei: „Man darf nicht nur Striche zusammenzählen.“
„Die Polizei wird in Zukunft eine Entspannung vorfinden“
Behrendes glaubt nicht, dass die Gewaltbereitschaft der Bürger in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen ist. Schon Anfang der Siebziger war er im Dienst. „Da waren Polizisten für Gleichaltrige die Buhmänner.“ Auf den Demos flogen ihm Steine um die Ohren, die Schutzausrüstung war erbärmlich, verglichen mit der heutigen. „Von respektvollem Umgang habe ich nichts erlebt.“
Seit 2009, das zeigt die Statistik des Bundeskriminalamtes, sinkt der „Widerstand gegen die Staatsgewalt“. Im Bericht über das Jahr 2011 steht: „Die Zahl der Fälle von Widerstandshandlungen gegen die Staatsgewalt war - wie bereits im Jahr 2010 - auch 2011 rückläufig.“ Gegenüber dem Vorjahr sei die Zahl um 2,3 Prozent auf 22.839 Fälle zurückgegangen.
„Es gibt keine Automatik, dass alles immer schlimmer wird“, sagt auch der Forscher Pfeiffer. Im Gegenteil. „Die Polizei wird in Zukunft generell eine Entspannung vorfinden.“ Seine Studie habe gezeigt, dass vor allem junge Männer Polizisten angriffen. Die Gesellschaft wird aber im Schnitt immer älter. „Ich bin sicher, dass die Gewalt gegen Polizeibeamte abnehmen wird.“
„Besser, man versteht einander“
Schon vor Jahren hatte der Professor das in einem offenen Brief an die Justiz- und Innenminister des Bundes und der Länder angemerkt. „In unserem Land wird nicht zutreffend über Kriminalität berichtet“, schrieb er und kritisierte die „wachsende Dramatisierung des Bösen“. Gute Nachrichten würden verschwiegen. „Liegt es vielleicht daran, dass Gewerkschaftsfunktionäre und Innenminister in der Sorge vereint sind, die Finanzminister könnten bei Kenntnisnahme der positiven Entwicklung auf die Idee kommen, im großen Stil Planstellen der Polizei zu kürzen?“
Liefern die Wissenschaftler die gewünschten Ergebnisse, zitieren die Gewerkschaftler sie gern. Wenn nicht, schmähen sie sie als Bücherwürmer. „Ich bin etwas länger Polizist als Herr Behr“, trotzt der Hamburger DPolG-Chef Joachim Lenders. Er residiert in einem Riesenbüro gegenüber vom Hotel Atlantic und trägt Anzug, aber seine Worte sollen so klingen, als stünde er mitten im Straßenkampf (er holt sogar ein Wurfgeschoss von einer Demo aus der Schreibtischschublade). Wendt versucht es mit der gleichen Methode: Behr sei „ja erstmal ein Sozialwissenschaftler“, der vom Polizeialltag nichts verstehe. „Sehr, sehr eingeschränkt“ sei dessen Sicht.
Dass der Hamburger DPolG-Chef sich den Forscher nach dem Jammervorwurf „gleich vorgeknöpft“ habe, sei wirkungsvoll gewesen: „Seitdem ist da an der Front Ruhe. Das macht der nicht nochmal.“ Rainer Wendt, zurückgelehnt in seinem Bürosessel, will noch was sagen zur Causa Behr, es soll versöhnlich klingen: „Besser ist, man versteht sich miteinander.“ Es klingt wie eine Drohung.