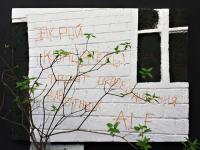Die deutsch-irakische Künstlerin Lin May setzt sich in ihren Arbeiten mit dem Mensch-Tier-Verhältnis auseinander. Ihre künstlerische Praxis umfasst Texte, Zeichnungen, Skulpturen und Scherenschnitte. 2003 gründete sie den Ausstellungsraum Center in Berlin. Neben regelmäßigen Ausstellungen in Galerien hat sie ihre Arbeiten auch bei Tierbefreiungs-Veranstaltungen gezeigt, z. B. beim New Roads of Solidarity-Antirepressionskongress in Hamburg, 2010.
Ich besuche Lin May abends in ihrem Atelier in Berlin, wo einige
großformatige Werke in Arbeit zu sehen sind sowie, auf zwei Tischen
ausgebreitet, eine größere Anzahl Zeichnungen auf
Schreibmaschinenpapier. An einer Wand lehnt zwischen einem Schweißgerät
und einer Werkbank ein Bild aus Stahlgittern, eine Art demontiertes
Gartentor. Obwohl noch in Arbeit, verrät die Wandzeichnung dahinter,
dass es eine_n Tierbefreier_In darstellen wird, die/der auf den Armen
ein Tier wegträgt; daneben ist der Fernsehturm zu sehen, der das
Geschehen eindeutig in Berlin verortet. Berlin ist bekanntlich
Deutschlands Hauptstadt der Tierversuche, ein Ort, in dem Tierausbeutung
hinter geschlossenen Türen stattfindet. Wir reden über das Bild: ob der
Fernsehturm als visuelles Signal für Berlin ausreicht; ob noch Text
notwendig wäre oder ob es schon für sich spricht; über die Dynamik, die
sie in dem Bild erzeugt hat; und über das dargestellte Tier, das, wie
die menschliche Figur, so wenig spezifisch ist, dass es für alle Tiere
stehen könnte. Sie zeigt mir einige Skizzen, die die Basis ihrer Arbeit
formen. Auf einem Tor-Entwurf ist ein Hummer zu sehen, um den sich das
Wort ‚Liberation‘ schlängelt. „Hier hatte ich Bedenken wegen des
Hummers. Jemand, der sich mit der Materie auskennt, versteht das, für
Außenstehende sieht es wohl nach der Fress-Etage vom KaDeWe aus.“
„Aber
mit dem Wort ‚Liberation‘ drauf kann man das gar nicht mehr denken“,
entgegne ich.
„OK, du
hast Recht. Vielleicht könnte man das doch machen. Die Gefahr bei
diesen Türen ist, die sind eben sehr schön. Formale Entscheidungen im
Zusammenhang mit der Arbeit werden am ehesten honoriert, wie etwa dieses
Gelb oder wie präzise die Drähte gebogen sind – eigentlich hat das was
mit Übung zu tun.“
„Das
Mensch-Tier-Verhältnis ist schon lange Thema deiner Kunst, seit deiner
Studienzeit. Kannst du diese Entwicklung beschreiben?“
„Einzelschicksale von Tieren haben mich schon immer interessiert, ich
habe aber nicht die übergeordneten bzw. strukturellen Zusammenhänge
erkennen können, innerhalb derer Tierausbeutung legitimiert wird.
Während meiner Studienzeit lernte ich durch einen Kommilitonen an der
Kunstakademie Melanie Bujok kennen. Melanie war offen für meine Fragen
und ohne Dünkel. Dass man die Chance erhält, einen Zugang zum
Tierrechts-/Tierbefreiungsgedanken zu bekommen, hat glaube ich ziemlich
viel damit zu tun, dass man mit jemandem in Dialog treten kann, der
sich, so wie sie, um präzise Formulierungen bemüht und versucht eine
Sprache für sich zu entwickeln, aber gleichzeitig auch fair reagiert auf
einfache Fragen von außen. Ich weiß gar nicht, wie es gewesen wäre,
wenn sie anders reagiert hätte. Aber ich bin auch ziemlich
frustrationstolerant, und denke das ist OK, weil ich mittlerweile weiß,
was es für jemand bedeutet, eine Million mal die gleichen Fragen zu
beantworten.“
„Aber diese Gesprächsbereitschaft ist auch total wichtig…“
„Ja.
Zum Beispiel Fragen wie – ‚Lebst du mit Tieren zusammen, welche sind
deine Lieblingstiere?‘. Ich weiß nun, das spielt gar keine Rolle, aber
ein Außenstehender kommt erst mal so zu diesem Thema. Das ist noch
dieses ‚Ein Herz für Tiere‘-Niveau, mit dem wahrscheinlich viele erst
mal ankommen, und wenn man dann merkt, wie umfassend dieses Thema ist,
ahnt man erst die politische Dimension. Dann beginnt auch der Versuch
die eigene Sprache weiterzuentwickeln.“
„Und in
deiner Kunst? Bist du auch noch dabei eine Sprache zu entwickeln?“
„Ja,
und es geht momentan etwas leichter als noch vor einiger Zeit. Aber
jede tatsächliche Tierbefreiung ist wichtiger, als das was ich hier
mache. Es ist nichts Besonderes, es ist einfach das, was ich leisten
kann, aber ich glaube nicht, dass wir von einem Kunstwerk und der Kunst
generell besonders viel erwarten können.
Es muss
verschiedene gesellschaftliche Bereiche geben, wo das Thema eingebracht
wird, und dies ist nur einer davon.“
„Aber
es ist irgendwie mehr. Zum einen bringst du, wie gesagt, das Thema in
einen gesellschaftlichen Bereich, der normalerweise nichts von der
Tierbefreiungsbewegung oder von Tieren etwas mitbekommt, aber
anderseits, ich finde eine Bewegung braucht Bilder für und von sich,
einen Kontext für uns, wo wir uns sehen. Eine Bewegung und eine
bestimmte Einstellung muss gefeiert werden und das machst du auch. Du
feierst eine Bewegung und eine Meinung, die oft nicht beachtet wird. Für
mich ist das eine Bereicherung. Wie hat Deine Serie ‚Die Befreiung der
Tiere aus den Käfigen‘ begonnen?“
„Das
war 2006, ich hatte mich schon einige Jahre mit der Tierrechtsbewegung
beschäftigt. Ich sah eine DVD mit Film-Dokumentationen von
Tierbefreiungen, unterlegt mit Punkmusik, sie hieß Animal Liberation –
History of the Making. Das hat mich so geflasht! Es hatte so was ganz
Konkretes und es war wie eine Art Kampf-Sport, der aber Sinn macht. Das
war der Anlass, Kunst über Tierbefreiung zu machen: Das ist möglich. Es
ist möglich! Das ist natürlich eine Art Philosophie, aber auch etwas,
was praktisch machbar ist, du kannst Tiere aus den Käfigen holen. Das
kann man abbilden. Tierrecht ist hingegen ein abstrakter Begriff. Und
das ist sicher nur einer der Gründe, warum Tierbefreier sich jetzt
Tierbefreier nennen und eher nicht mehr Tierrechtler. Ich habe das so
verstanden, dass man sich nicht erst zum gültigen Rechtsbegriff ins
Verhältnis setzen wollte, um für Tiere aktiv werden zu können. Oder
auch, dass man diesen Rechtsbegriff ohnehin ablehnt. Das ist zudem
zeitraubend und für die Kunst kommt hinzu, dass Recht ein abstrakter und
unabbildbarer Begriff ist. Befreiung ist hingegen eine Handlung, die
darstellbar ist.“
„Das
macht total Sinn. Ich habe nie gewusst, wie ich Kunst über Tierrechte
machen soll, ich wusste aber nicht, warum das so ist. Und als du das
sagtest, fiel mir auch auf, dass viel Künstler_innen, die sich mit dem
Thema auseinandersetzen, eher Bilder von Tierausbeutung machen.“
„Was
absolut legitim ist. Es ist gut, wenn es diese verschiedenen Ansätze
gibt.
Mich
interessiert aber auch eine Utopie, eine idealistische, alternative Welt
zu entwerfen. Auch wenn man sich nicht nur damit beschäftigen kann,
sonst wird man irgendwann Esoteriker und das führt zu nichts. Befreiung
ist als Handlung hingegen praktisch und klar und es soll ein Vorschlag
sein an die Gesellschaft, dies als konstruktive Handlung anzuerkennen.
Im Moment hab ich das Gefühl, dass das Thema nun langsam etwas mehr
wahrgenommen wird.“
„Am Anfang sahen deine Arbeiten noch anders aus, oder?“
„Ja.
Seit 1998 habe ich mich zunehmend mit dem Tierbefreiungsgedanken
auseinandergesetzt, aber trotzdem nicht direkt in meiner Arbeit darauf
reagiert.
Ich war
unsicher, und andere Künstler, die mir gut gesonnen waren, sagten mir,
mache deine Arbeit, mach deine Tierskulpturen, aber sag bloß niemand,
dass du dich für Tierrechte interessierst. Das will keiner wissen. Geh
auf Demos usw., aber guck, dass du es auseinanderhältst. Und ich dachte:
Ja, OK, es ist vielleicht besser, zumal ich auch noch keinen Bildansatz
hatte. Verunsichert war ich auch darüber, ob es überhaupt legitim ist,
weil es nicht selbstverständlich ist, ein konkretes soziales Anliegen zu
bearbeiten. Es gibt so eine Art Regel der zufolge die Kunst neutral zu
sein hat. Da fehlten auch Vorbilder; und dort, wo ich studiert habe, an
einer staatlichen Akademie, ist es nicht gerade naheliegend, sozusagen.
Und ich war ziemlich happy. Ich hatte ein paar Tierskulpturen verkauft
während der Jahresausstellungen im Studium, also ziemlich viel, da hab
ich so viel verkauft wie später lange Zeit nicht mehr. Und so konnte ich
mir damals z. B. leisten, in Düsseldorf Sendezeit bei Infoscreen zu
mieten in der U-Bahn, um eine Anti-Pelz-Werbung zu schalten, was ein
paar tausend DM gekostet hat. Und ich dachte, ja das ist keine schlechte
Version: ich mache schöne Tierskulpturen und mit dem Erwerb kann ich
dann das finanzieren, worum es mir geht. Natürlich war diese Werbung
auch keine künstlerische Arbeit, sie sah aus wie von einer Werbeagentur.
Ein Bild von einem Fuchs in einem Käfig, ich wollte erst mal ein
ziemlich schreckliches Foto nehmen, Tötung mit Elektrostäben, und
entsprechende Bildunterschrift, das wurde aber nicht akzeptiert. Am Ende
habe ich mich dann auf ein weniger anderes Motiv mit denen geeinigt,
das sah ein bisschen aus wie von Peta, würde ich heute sagen ... Es hat
ein paar Jahre gedauert, bis ich dachte, dass es besser ist, die
künstlerische Arbeit und das Anliegen, der Mensch-Tier-Problematik zu
mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen, als eines anzusehen. Mir waren auch
zuletzt immer weniger harmlose Motive mit Tieren für Skulpturen
eingefallen.
Was
auch ein guter Moment war, das war dann einige Jahre später, 2008.
Ich
hatte einen sehr großen Scherenschnitt angelegt und darüber
nachgedacht, wie könnte ein Tierbefreier aussehen, der nicht vermummt
ist? Wie kann ich ihn als ein Stereotyp abbilden? Ich hielt es für gut,
wenn es weder Mann noch Frau ist, wenn es beides sein kann, androgyn. Es
war nicht wichtig, was er oder sie anhat, aber ich musste mich
entscheiden für eine Frisur. Ich kannte damals niemanden in der
Tierbefreiung mit Dreads, aber ich entschied mich für diese Version. Ich
konnte mir das vorstellen und mochte die Verbindung mit Rasta. Dann bin
ich mit der Arbeit nach Hannover gefahren, um sie auf dem
Tierbefreiungskongress aufzubauen, und die Ersten, die mir entgegenkamen
am Tor des UJZ Korn, war ein Paar, beide hatten diese riesige Frisur
und sie waren sehr freundlich und haben mich begrüßt. Das war schön, als
ob sie genau aus meinem Bild spaziert wären. Hannover hat mir total
viel gebracht. Aus dem Programm konnte man von drei Sachen immer nur zu
einem gehen, aber bei jeder einzelnen Veranstaltung, über die ich im
Programm las, da dachte ich: wow, hier bin ich am richtigen Ort! Ich
weiß gar nicht, wo ich hingehen soll, weil alles interessant ist und
zukunftsweisend. Leider konnte ich nur wenige Workshops besuchen, weil
mein Aufbau so lange gedauert hat. Ich habe dann aber zwei Jahre später
das Programm des Kongresses als Textarbeit in eine Ausstellung
integriert.“
Lin
spricht auch kritisch über die sprachlichen und visuellen Codes der
Tierbefreiungsbewegung und wie diese dazu führen können, Menschen
auszuschließen, oder sie daran behindern können, sich zu beteiligen.
„Als
ich im Gespräch mit jemanden auf dem Kongress in Hannover erwähnte, dass
ich die Bilder meiner Arbeiten meistens selber ‚schießen‘ würde, lief
gerade jemand an mir vorbei, der auf dem Kongress auch ein Seminar
leitete, und kritisierte mich dafür, dass ich das Wort ‚schießen‘
verwendet hatte. Er war an dem Gespräch gar nicht beteiligt und hatte es
einfach nur zufällig mitgehört, wir kannten uns gar nicht. Eine Frage
an Dich, Clare: Darf man Flohmarkt sagen? Eigentlich nicht, oder? Hast
du mal gehört, dass jemand Flohmarkt nicht sagt? Ich hatte mal so ein
Comic gezeichnet. Es waren zwei Tierbefreier, beide vermummt, und der
eine sagt zum anderen: ‚Wenn du noch einmal Flohmarkt sagst!‘ (lacht)
Manchmal reicht es in der Bewegung wohl schon, wenn man optisch nicht
dazu passt, um ausgegrenzt zu werden. Von den Tierrechtstagen in Lohra
2009 ist jemand früher abgereist, der sich ausgeladen vorkam, weil er
von einigen für einen Spitzel gehalten wurde und man ihm das auch
mitgeteilt hat. Mir haben übrigens auch einige Kids dort zu verstehen
gegeben, dass ich auf sie keinen vertrauenswürdigen Eindruck mache. Aber
das macht mir nichts aus, da ich ohnehin eher eine Einzelgängerin bin.
Eigentlich sind das alles Peanuts. Befindlichkeiten sollten uns nicht
davon abhalten, wirklich alle an einem Strang zu ziehen und auf allen
erdenklichen Ebenen das Leid der Tiere zu bekämpfen.
Ein anderes Thema, das ich an dieser Stelle gerne ansprechen möchte: Wir sollten uns mehr trauen in der Auseinandersetzung mit Leuten, die einen Migrationshintergrund haben. Ich habe selbst einen arabischen Hintergrund durch meinen Vater, meine Mutter hat jüdische Wurzeln, daher fällt es mir vielleicht leichter das zu sagen. Es muss möglich sein, dass man andere Kulturen kritisiert, sonst geht’s nicht weiter. Wenn ich jemanden ernst nehme, dann kann ich, bzw. muss ich ihn auch kritisieren können. Ich verstehe, dass es ein riesiges Problem gibt, wenn man da nicht sehr präzise arbeitet, man darf nicht auch nur ansatzweise in das Fahrwasser rechten Denkens geraten. Aber man muss genauso darauf achten, nicht handlungsunfähig zu werden, aus Angst, nicht politisch korrekt genug zu handeln oder zu argumentieren.“
„Noch
einmal zurück zu deiner Arbeit: Kannst du mir noch etwas über deine
Auswahl an Materialien sagen, die du als ‚arme Materialien‘ bezeichnest.
Styropor und andere Baustoffe sind schon eher ungewöhnlich in der
Kunst. Der Stahl, den du für die Tore benutzt, ist ein häufiger
benutztes Material für Skulptur, aber die Art, in der du ihn
verarbeitest, ist wieder recht ungewöhnlich.“
„Die
Tore oder Türen sowie auch die Scherenschnitte resultieren aus
Zeichnungen. Ich mag Zeichnung, weil sie das direkteste Medium ist, eine
Möglichkeit nachzudenken, und gleichzeitig eine Art, das Denken zu
überprüfen und zu erweitern. Im Gegensatz dazu ist zum Beispiel Malerei
ein Feld, das stark frequentiert und segmentiert ist, da ist die
Notwendigkeit der Abgrenzung und um diese ganze Claim-Problematik möchte
ich mich nicht kümmern müssen. Bei den von mir gewählten
Vorgehensweisen habe ich das Problem nicht. Ich strebe in der Zeichnung
auch keinen einheitlichen Stil an. Es geht um den Inhalt, die Frage nach
der Ästhetik und Wiedererkennbarkeit ist zweitrangig. Ich sehe nicht,
was der Corporate-Identity-Gedanke in der Kunst zu suchen hat, es sei
denn, man würde sich gezielt damit beschäftigen wollen. Mit der
Überführung des Motivs, das zunächst nur auf Schreibmaschinenpapier
skizziert ist, zu in einen Raum füllenden Scherenschnitt wird der
Stellenwert klar, den ich dem Thema beimesse. Das ist der Grund, weshalb
ich es umsetze in diesem Format. Mit der Skulptur ist das etwas
anderes. Das ist die größte Herausforderung, auch weil sie 36o° Ansicht
hat, und wenn man verschiedene Blickwinkel mit einbezieht, sogar noch
mehr. Von den abstrakten Erfordernissen her ist es die komplexeste
Aufgabe und weist auch über jedes Thema hinaus. Ich arbeite an einer
Skulptur oder einem Relief bis zu dem qualitativen Punkt, wo ich weiß,
jetzt könnte ich es auch in ein höherwertiges Material überführen, wie
Bronze oder Alu. Insofern ist das noch ein Bezugsmoment, wenn ich es
auch ansonsten ablehne, die Arbeit auf diesem Weg aufzuwerten. Ich habe
früher einige Arbeiten gegossen, aber das Komische ist: eigentlich tut
das den Arbeiten gar nicht so gut. Wenn es nicht sein muss, dann muss
man es lassen. Wenn es für die Arbeit wichtig ist, weil sie
beispielsweise stabil und witterungsfest werden soll, ist das OK,
konzeptuell ist es eher kontraproduktiv.
Was
die Tore angeht, für diese Arbeiten gab es Vorbilder. Ich fahre häufig
nach Vorpommern, wo man viele von Hand geschmiedete Zäune und Tore sehen
kann.
In
West-Deutschland gab es den typischen industriell gefertigten Jägerzaun
oder Maschendrahtzaun, aber nicht in der ehemaligen DDR. Rohmaterial war
verfügbar, deswegen konnte bzw. musste man sich in Ost-Deutschland
selber Muster und Motive überlegen. Die Schlosser dort haben
verschiedene Motive variiert, die Ergebnisse sahen immer etwas anders
aus. Meistens waren es einfache geometrische Muster oder Sonnenmotive.
Vieles davon ist heute noch in ländlichen Gebieten erhalten und es
springt einem sehr ins Auge, ebenso wie die individuellen Sitz- und
Parkbänke dort. Tore oder Türen haben auch eine Art symbolische
Bedeutung. Ich stelle mir eine Tür vor, die aus den Angeln gehoben,
vielleicht abgestellt ist. Oder vielleicht gibt es eben noch nicht den
richtigen Zusammenhang, also den Ort oder das Gebäude für diese Tür. Und
so könnte man es mit der Tierbefreiung sehen. Noch ist es ein Ideal,
die Zeit muss kommen.“
Interview geführt von Clare McCormack für die tierbefreiung. Clare studiert freie Kunst an der University of Leeds und Burg Giebichenstein, Halle.
http://www.center-berlin.com