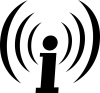* Belarus: Transnationale Aktion, Repression und Vernetzung
* Flashmobs in Minsk für die Stilllegung aller Atomanlagen und gegen den geplanten AKW-Neubau
Eigentlich geht es nur um drei kurze Flashmobs an zentral gelegenen Orten der Stadt. Mit Flyern und Bannern, Reden und Parolen. Unproblematisches Standardprogramm für AktivistInnen aus der BRD. Aber diesmal sollen die Aktionen in Minsk, der Hauptstadt von Belarus, stattfinden.
Nicht selten wird dieser Staat als „letzte Diktatur Europas“ beschrieben. Nicht zuletzt, um sich selbst ins rechte Licht zu rücken und von eigenen gesellschaftlichen Zumutungen abzulenken. Auf Einladung von AnarchistInnen vor Ort sind wir vor einigen Tagen in Belarus angekommen. Das erste Mal in diesem Land, für viele.
Seit der erhöhten anarchistischen Aktivität und den pro-demokratischen Protesten gegen die (vermutlich) gefälschten Wahlen im Herbst letzten Jahres rattert die Repressionsmaschine auf Hochtouren. Hausdurchsuchungen, Verhaftungen, falsche Anklagen, Psychoterror. Wir müssten davon ausgehen, unter andauernder Beobachtung zu stehen, sobald wir das Land betreten, wurde uns im Vorfeld prophezeit. Entsprechend klandestin gingen die gemeinsamen Aktionsvorbereitungen in Minsk vor sich. Umwege mit den öffentlichen Verkehrsmitteln – aber keine Metro. Denn die ist videoüberwacht. Von einem Treffpunkt zum nächsten, nicht lange stehen bleiben, bis wir uns in einem Park zusammen finden. Wir stellen fest: Die Einschätzungen zu Sicherheit und Risiken gehen weit auseinander und kollidieren auch mit unseren Sicherheitsstandards aus Deutschland. Wie mit Handys umgehen? Welche Wege gehen? Welche Treffpunkte wählen? Wie fortbewegen?
Was die möglichen Konsequenzen der Aktion angeht, gibt es ähnlich große Unklarheiten: 15 Tage Knast für eine unangemeldete Kundgebung sind rechtlich drin. Einige unserer belarussischen FreundInnen meinen allerdings, mit dem deutschen Pass in der Hand würde uns keiner mehr anfassen. Dazwischen und darüber hinaus scheint alles möglich. Klar, auch Abschiebungen. Hört sich alles nach totaler Willkür an.
Ostermontag. Der Tag der Aktion. Wir sitzen im Innenhof zwischen grauen Hochhaus-Platten. Überhaupt scheint fast die ganze Stadt aus ihnen zu bestehen. Beton, soweit das Auge reicht. In allen Altersgraden, Formen und Größen. Beständig breitet er sich aus, wird mehr und ist omnipräsent. Bedrückend. Genauso wie das Regierungsgebäude, vor dem wir gestern standen. Seine Präsenz schien uns zu zerquetschen. Und in den Parks knutschende Pärchen in der Sonne. Wir besprechen die letzten wichtigen Dinge: Wie geht es uns? Welche Ängste haben wir? Wie weit wollen wir gehen? Wie wollen wir uns wann verhalten? Eine Polizeistreife kommt auf uns zu. Kurze Aufregung, dann Erleichterung: Wir sollen die Füße von den Bänken nehmen. Das sei in diesem Land verboten.
Dann, dicht gedrängt in Bussen zum Aktionsort. Wir fallen hier auf. Unsere Kleidung, unsere Sprache, unsere Frisuren. Eigentlich fast alles. Trotzdem gibt es nur selten eine Interaktion mit den Menschen, die uns dicht umringen. Oder vielleicht gerade deshalb? Wir wissen es nicht. Das allgemeine gesellschaftliche Klima fühlt sich repressiv an. Wir steigen aus. Der Aktionsort: der Eingang eines Einkaufszentrums. Wieder streunen wir durch einen nahe gelegenen Park zwischen grauen Hochhäusern. Viele bekannte Gesichter erblicken einander, laufen aneinander vorbei. Angespannte Ruhe. Plötzlich dröhnt rhythmische Musik aus einer nahe gelegenen Platte. Die Stimmung steigt.
Die Kleingruppen ziehen sich zusammen. Vor dem Haupteingang des Einkaufszentrums werden Transparente entrollt, Reden gehalten, Parolen gerufen, Flyer verteilt. Alles läuft wie geplant. PassantInnen zücken ihre Handys, unsere Fotografen fotografieren, ein oppositionelles Fernsehteam filmt. Nach 10 ist das Spektakel vorbei. Die Zuversicht ist groß. Weit und breit keine Cops. Wir packen ein, verstreuen uns in Kleingruppen, laufen in verschiedene Richtungen, quetschen uns in verschiedene Busse. Auf zum nächsten Aktionsort. Große Kreuzung, große Bushaltestelle –the same procedure.
Plötzlich geht alles ganz schnell: Schreie. Für den Bruchteil einer Sekunde gibt es Verwirrung; anschließend die Beine in die Hand nehmen. Die Cops. Aber wo? Nicht zurück schauen. Ist das meine Aktions-Partnerin, die gerade umgerannt wurde? Ich werde zu Boden gerissen. Eine Freundin befreit mich – irgendwie. Danke. Scheiße. Jetzt haben sie sie. Ich renne weiter. Im Augenwinkel sehe ich einen anderen Freund, der hinter einem Auto hockt. Er rennt mit. Ein Griff an den Nacken. Ich höre mein T-Shirt reißen und knalle aufs Pflaster. Ein großer und kräftiger Typ mit Anzug und Lackschuhen verdreht mir den Arm. Wir werden zu einem roten Bus geführt. Ich sehe nur Zivi-Cops, die auch andere FreundInnen ruppig in den Bus werfen. Erst drinnen stehen Typen, die wie Soldaten aussehen. Ein Wort, das sich sehr wie „Faschisten“ anhört, ist das erste, was ich höre. Und es wird nicht das letzte Mal sein.
Wir finden uns in einer „Amtsstube“ wieder. 5 Leute aus Belarus, 6 Leute aus der BRD und eine Polin. Einige der „Locals“ sehen ziemlich fertig aus. Wurden sie anders behandelt? Was bringt uns das Privileg eines deutschen Passes? Die Möbel sind braun in braun. Ein Schreibtisch. Darauf ein Computerbildschirm ohne Zubehör. Wie zur Zierde. Das kennen wir schon aus anderen Behörden, die wir als „Ausländer“ aufsuchen mussten, um uns versichern und registrieren zu lassen. Und dann: warten, wie überall anders auch. Gut, dass wir zusammen in einem Raum sind, denn diese Ungewissheit wird noch lange an uns nagen. Eine Frage wird gestellt. „Wir sprechen kein Russisch.“ „English?“ „Nein.“ Eine Lüge. „Wir brauchen Übersetzung.“ Das sei unser Joker, wurde uns von den BelarussInnen gesagt. Eine deutsche Übersetzung würden sie nicht hinkriegen und deshalb kämen wir schnell wieder raus. Falsch gedacht: „Sie organisieren die Übersetzung“, erklärt eine von uns, die ihre Russischkenntnisse versteckt hält. Unsere privaten Sachen haben wir noch. Auf dem Klo und unter Deckung der anderen telefonieren wir und schreiben SMS an unsere Leute draußen.
Die Zivilpolizisten, die uns bewachen, stellen sich als widerliche Halbstarke heraus. Es werden immer mehr, die uns begaffen und kommentieren. Wir werden zur Attraktion. Abwechselnd setzen sie sich an den Schreibtisch und spielen „Chef“. Sie fotografieren uns, zeigen uns offensichtlich montierte Bilder, von sich in Militär-Uniform mit einer Knarre im Anschlag und einer Explosion im Rücken. „That’s me!“ Zwischendurch kriegen sie eine Standpauke vom Vorgesetzten. Dann beginnt das Spiel von vorne. Gut, dass wir nicht verstehen, was sie sagen. Mit dem Unverständnis bleibt allerdings auch die Unklarheit. Die Unsicherheit. Die Angst, diesen Sadisten bedingungslos ausgeliefert zu sein.
Dann das Verhör. Kein Anwalt, keine Rechtsbelehrung, kein Telefon. Ein Typ mit Kamera sitzt gegenüber. „Ich möchte Widerspruch einlegen.“ „Wir sehen davon ab, Sie zu filmen, wenn Sie mit uns kooperieren.“ Sie haben mich doch sowieso schon gefilmt oder fotografiert, denke ich. „Ich verweigere die Aussage.“ Die Übersetzerin schildert meine Worte. Sie macht dies zum ersten Mal, sagt sie. „Die Behörde“ hätte bei ihr angerufen. Sie hätte ein Diplom, sagt sie. Ob sie sich freiwillig gemeldet habe. „Nein.“ Ob sie dafür Geld bekomme. „Nein.“ Sie ist vorsichtig mit dem, was sie sagt. Wie alle. Dann die Fingerabdrücke. Ich leiste Widerstand. Sie versuchen halbherzig, Zwang anzuwenden. und verzweifeln an mir. Dann setzt es einen Schlag in den Magen. Sofort werden die Beamten vom Chef zurück gepfiffen. Psychoterror statt rohe Gewalt scheint die Devise. Aus Deutschland kenne ich die Kombination aus beidem. Es ist tief in der Nacht. Zuletzt folgt die Durchsuchung und Beschlagnahmung unserer privaten Sachen. Einer der Führungskader hat schlechten, sexistischen, deutschen Hip-Hop bei YouTube angeschmissen. „Tanzen, tanzen!“ schreit er mit Akzent und schneidet die Schnürsenkel unserer Schuhe durch. Bei den Anderen von uns sitzen in der gleichen Situation auch zwei Frauen. Sie sehen fertig aus, wie von der Straße gefischt, wegen Prostitution oder Drogen-Geschichten. Sie werden als ZeugInnen gezwungen, die Beschlagnahmungs-Protokolle zu unterschreiben. Sie werden erniedrigt. „Hast du Kinder?“, fragt der Beamte. „Ja.“ „Aber die sitzen im Heim und du darfst sie nicht sehen“, lacht der Beamte dreckig.
Ab in die Zelle. Sie nehmen mir meine Brille weg. Auch mein Schal und meine Tücher werden eingezogen. Wir werden vermeintlich nach Geschlechtern getrennt. Die belarussischen FreundInnen haben wir schon längst aus den Augen verloren. Das Kondenswasser rinnt die Wände runter. Es stinkt. Es ist stickig. Ich kann kaum atmen. Mir ist schwindelig. Ich setze mich auf einen Absatz. Zwei kontinuierlich schimpfende Weißrussen sitzen mit uns in der Zelle. Sie schreien und hämmern an der Tür.
Dann Abtransport in den „richtigen“ Knast. Immer wieder müssen wir warten und das ewig lange bürokratische Prozedere setzt uns zu. Schlafentzug als Strategie? Gehört hat man davon. Jetzt sind die Zellen kalt. Blut klebt am Fensterrahmen. Scherben liegen daneben. Das Stehklo ist eine einzige Kloake und die Spülung funktioniert nicht. Klopapier gibt es keins. Ich kuschele mich an meinen Genossen und wache später zitternd auf. Jetzt könnte ich den Schal gebrauchen. Auf einer Holzbank liegend, starre ich mit verschwommener Sicht an die schmuddelig-gelbe Knastwand, von der Putz abbröckelt. Allmählich beginnt man das Gefühl für Zeit und Raum zu verlieren. Das Miniatur-Fenster aus Milchglas lässt nur diffuses Licht hinein. Wie spät ist es? Was passiert mit uns? Wie geht es den belarussischen GenossInnen?
Es donnert an der Tür. Wir wachen auf. Es ist schon längst hell. Das Schloss öffnet mit einem lauten Knall. Wieder warten, einsteigen, aussteigen. Irrfahrten durch die Stadt mit unseren halbstarken, ekeligen Junggesellen als ständige Begleitung. Es dämmert. Ist es nicht viel zu spät, um uns vor Gericht zu stellen? Dort angekommen sehen wir das erste Mal unsere GenossInnen von draußen wieder. Ein Lichtblick. Sie bringen uns große Plastiktüten mit Essen. Wir essen soviel, wie es die Nerven zulassen. Die belarussischen FreundInnen seien verprügelt worden. Verdacht auf Rippenbrüche und innere Blutungen. Keine Zeit zum Verarbeiten der Informationen. Wieder in Zellen und dann Abführen der Einzelnen in die Gerichtssäle. Die erste Freundin kommt weinend und zitternd zurück. „Das überfordert mich.“ Wieder Angst. 15 Tage? Abschiebung? Oder hängen sie uns jetzt auch noch irgendwelche Anschläge an? Ich bin einer der Letzten, der aufgerufen wird.
Der „Gerichtssaal“ ist eine kleine Kammer. Die Richterin betet die Paragraphen runter. Der Übersetzer scheint sympathisch zu sein. Ob ich eine/n AnwältIn möchte. „Ja.“ Auf sie wartend, sitze ich draußen auf dem Gang. Die Zivicops warten auch hier, betreten die verschiedenen Kammern und sagen gegen uns aus. Sie haben sich eine einigermaßen kohärente Story ausgedacht. Ein höheres Tier dieser Herde setzt sich neben mich. Er öffnet versteckt einen Briefumschlag mit einem Batzen Dollar-Scheinen und erklärt mir, dass dies ihr Lohn für ihre erfolgreiche Jagd gewesen sei. „Do you have money?” fragt er. Was soll das? Will er, dass ich ihn besteche und mich noch tiefer in die Scheiße reite? Ich winke ab. Die Anwältin kommt schließlich. Wenn ich die Aussage verweigere, könne sie nicht viel machen, sagt sie. Ich verteidige mich selber und befrage die ZeugInnen. Auf Rückfragen sind sie nicht vorbereitet. Sie widersprechen sich und können trotz vorheriger Absprachen keine eindeutigen, belastenden Aussagen mehr machen. Wir müssen raus bis zur Urteilsfindung.
Die Anderen hätten Geldstrafen bekommen, sagt mir der Rechtsberater der deutschen Botschaft, der jetzt vor Ort ist. Uns weitergeholfen hat er während des Prozesses nicht. Trotzdem beruhigt uns seine Anwesenheit ein wenig. Ich spreche mit der Anwältin und dem Übersetzer. Auch sie wägen, offensichtlich aus Angst, genau ihre Worte ab, scheinen aber Sympathien für uns zu haben. Sie geben mir Tipps für zukünftige Befragungen der ZeugInnen. Die Polizisten im Gang warnen meine Anwältin: „Die sind gefährlich.“ Sie bricht das Gespräch ab. Zurück in der Kammer. Ich sei schuldig. Eine Geldstrafe von umgerechnet 200 Euro lautet das Urteil. Wie für alle Anderen auch. Ein abgekartetes Spiel, denke ich: Das Urteil stand bereits vorher fest. Trotzdem herrscht Erleichterung. Keine längere Haft? Abschiebung? Oder einfach raus in die Freiheit? Für alles Weitere sei sie nicht zuständig, sagt die Richterin. Das sei Polizeirecht. Die Botschaft sagt uns, ihr wäre gesagt worden, dass wir jetzt zurück auf die erste Wache kämen. Sie würden uns hinterherfahren und sich für uns einsetzen.
Es tut gut, die Anderen im Hinterhof des Gerichtsgebäudes in die Arme zu nehmen. Doch kaum gibt es etwas Klarheit, verschwimmt sie wieder im Nichts und die Verzweiflung kehrt zurück. Unsere permanenten Bewacher setzen uns erneut in einen Transporter. In dem Gebäude, zu dem sie uns bringen sollen, waren wir noch nicht. Die Botschaft wurde also belogen. „Migrations-Polizei“ liest uns unsere heimliche Übersetzerin vor. Mittlerweile ist es wieder dunkel. Und scheinbar sollen wir psychologisch noch einmal richtig fertig gemacht werden. Sie werden uns abschieben, aber vorher müssten wir zahlen: die Strafe, die Fahrkarten für die Begleitpolizisten, für unsere „Unterkunft“. Bis das Geld da sei, blieben wir im Knast. Unser einziger Kontakt werde die Botschaft sein. Wie lange es dauere, die Abschiebung zu organisieren und alle Formalitäten zu erledigen, sei unklar. Vielleicht Tage. Vielleicht Wochen. Zwei ÜbersetzerInnen aus den Gerichtsverfahren wurden von der Polizei „konfisziert und mitgenommen. Ungefragt und unbezahlt natürlich. Einer von ihnen lässt uns heimlich sein Handy nutzen. Wir stecken ihm einen Zettel mit einem unserer Kontakte von draußen zu. Er solle alles erzählen, was hier geschieht. Er sagt, dass er erstmal ausschlafen und sich dann eine neue SIM-Karte kaufen müsse. Trotz seiner Solidarität hat auch er Angst. Sein Anruf ist kurz. Er ist unsicher und verständlicherweise misstrauisch.
Unsere Aufseher sind verschwunden. Wir werden von Cops zurück in den „alten“ Knast gebracht. Wieder Schlafentzug. Formulare, die unsere polnische Freundin für uns übersetzt, werden zunächst vorgelesen und dann sollen wir unterschreiben oder die Unterschrift verweigern. Die Prozedur dauert 4 Stunden. Es dämmert schon. Diesmal sollen wir wohl länger sitzen. Am Morgen gibt es das erste Mal seit langen etwas Essen. Ein schlechtes oder gutes Zeichen? Versalzener Haferschleim mit einer Tasse Schwarztee. Wieder knallt die Tür aus dem Schloss. Finger- und Handabdrücke in dreifacher Ausführung. Ich leiste keinen Widerstand mehr. Ich kann nicht mehr. Spüre keinen eigenen Willen mehr. Der Polizist sieht grob aus. Scheint abschätzige Kommentare zu machen. Lacht dreckig. Ich will keine physische Gewalt erfahren in dieser Situation geistiger und körperlicher Ermüdung. Wir haben Bücher und Schreibzeug in der Zelle. Schreiben, schlafen, lesen, reden. Vegetieren, aber eher vor uns hin. Warten auf die Nachricht: „Der Konsul ist da.“ Aber sie kommt nicht. Stunden verstreichen. Wie spät ist es? An der Tür klackt es. Endlich? Nein, nur „Essen“. Eine dünne Suppe. Und ein Klumpen altes Brot.
Dann eine Stimme vor unserer Tür, genau da, wo sich die „Rezeption“ befindet. Ja, das muss er sein. Ein Genosse von draußen ist da. Die Lebensgeister kehren sprungartig zurück. Das Ohr an der Tür. Ja, er ist es. Aber wie soll das gehen? Was ist los? Wie ist er hier reingekommen? Wurde er jetzt auch noch verhaftet? Wird er gleich zu uns in die Zelle geschmissen? Das bekannte Klacken ertönt. Nein, er steht da, lächelt sanft und nimmt uns in den Arm. Wir werden in vier Stunden zum Zug gebracht und nach Warschau abgeschoben. 2 Jahre Einreiseverbot. Unsere FreundInnen draußen hätten schon unsere Tickets gezahlt. Die Strafe müsse erst in vier Wochen beglichen werden. Die Zeit sei um, schreit der Wärter. Die Sekunden schleichen dahin. Das Ende scheint absehbar. Aber die Hoffnung war ja schon fast gestorben und will noch nicht so ganz rein in unsere Köpfe. Dann das letzte befreiende Klacken. Wir müssen uns beeilen, der Zug fährt bald.
Am Bahnhof dann das große Wiedersehen, gefolgt von einem zu kurzen Abschied. Belarussische GenossInnen und unsere deutschen UnterstützerInnen von draußen. Aber auch der KGB sei vor Ort, wird uns gesagt. Unauffällige Männer mit Kameras. Dieses Abschiedsszenario scheint die perfekte Gelegenheit, um Informationen zum Anlegen von Szene-Profilen zu gewinnen. Wer ist da? Auch eigentlich unbeteiligte GastgeberInnen sind vor Ort. Welcher Gefahr setzen sie sich aus? Wer umarmt wen? Welche Geschenke gibt es zum Abschied? Durch den Fensterschlitz des gekippten Zugfensters geben wir ein Interview für einen belarussischen Oppositions-Sender names „Belsat“, der von Polen aus sendet. Als wir aus den schwerindustriellen Hallen mit ihrem orangefarbenen Licht rollen und die verrußten Gesichter der ArbeiterInnen kleiner werden, scheinen wir in eine andere Welt zu rollen. Und so wird es auch in den nächsten Tagen sein. Die blühenden Wiesen und Bäume in Warschau. Das fast sommerliche Berlin. All das wirkt surreal vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen in den letzen Tagen.
Was bleibt, sind große Fragezeichen: Wie kann transnationale Solidarität aussehen? Wie gehen wir mit unseren Privilegien um? Was für ein Fazit werden die belarussischen AktivistInnen ziehen? Welche sinnvolle Rollen und Aufgaben gibt es für AktivistInnen aus Westeuropa in diesen Netzwerken? Wie verhalten wir uns in Ländern mit repressiveren gesellschaftlichen Verhältnissen und mit weniger Zugang zu materiellen Ressourcen? Was heißt Repression für den Widerstand im Spannungsfeld zwischen privilegierten und lokalen AktivistInnen?
Wenn uns diese Reise eines gelehrt hat, dann, dass wir dieser transnationalen Solidarität, so schwierig sie auch sein mag und so viele Fehler auch passieren können, Kontinuität verleihen wollen. (Und das kollektive Repression auch oft Verbundenheit zueinander schafft und Menschen zusammen rücken lässt.) Auf dass wir zusammen genug Kraft schöpfen, um die gesellschaftlichen Verhältnisse hier wie dort umzuwerfen.
Artikel aus Graswurzelrevolution Nr. 360