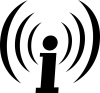Verdeckte Ermittler*innen in der linken Szene: Die Doku „Im inneren Kreis“ fragt nach den Gründen und Grenzen der Überwachung.
Iris P. war so, wie man sich eine Freundin wünscht: offen, witzig und nett, sie half bereitwillig beim Renovieren und organisierte Geburtstagsgeschenke, war immer für andere da. So erinnert sich Tanja an ihre vermeintliche Freundin, während sie am Tresen des linken Zentrums Rote Flora in Hamburg sitzt. Nur, dass P. gar nicht Tanjas Freundin war, sondern eine verdeckt ermittelnde Polizistin im Auftrag des Bundeskriminalamts und des Staatsschutzes. P. wurde dafür bezahlt, Freundschaften vorzutäuschen, um Informationen über die linke Szene zu sammeln und sie an die Behörden zu liefern.
Im Dokumentarfilm „Im Inneren Kreis“, der am 10. Juni mit einer bundesweiten Kinotour startet, fragen die Regisseur*innen Hannes Obens und Claudia Morar nach den Folgen der verdeckten Einsätze für die Überwachten. Und sie suchen nach Erklärungen. Denn neben den Fragen der Betroffenen, warum gerade sie ins Fadenkreuz gerieten und welche ihrer persönlichen Daten der Staat gespeichert hat, bleiben auch strukturelle, gesellschaftliche Fragen. Wer wird überwacht, wer nicht? Warum schleust der Staat Spion*innen in offene, linke Strukturen ein, warum nicht ins rechte Milieu? Was bringen die Ermittlungen, was sollen und was dürfen sie? Wie weit geht die Überwachung und was sind die Konsequenzen?
Obens und Morar haben anderthalb Jahre lang an dem Film gearbeitet, der ihr erster ist und den sie komplett aus Spenden finanziert haben. Weil sie nah an der Szene sind, gelingt es ihnen, den ZuschauerInnen einen persönlichen Einblick zu gewähren: Neben Politiker*innen und Anwält*innen, dem ehemaligen Generalbundesanwalt Kay Nehm, einem Polizisten und einer Psychoanalytikerin kommen hauptsächlich von den Einsätzen Betroffene zu Wort. Flora-Aktivist*innen und Überwachte aus dem Heidelberger Studierendenmilieu erzählen: Wie sie sich mit ihren vermeintlichen Freund*innen zum Kochen verabredet haben, wie sie Geburtstage zusammen feierten und was die Täuschungen für Wunden hinterlassen haben. „Es ist, wie wenn jemand stirbt“, sagt eine Exfreundin von Iris P.
Zurück bleiben Selbstzweifel, Schuldgefühle und die Frage: Wie konnte ich das zulassen? Eine allgemeine Erklärung kann es nicht geben. Aber die Dokumentation setzt die Ereignisse in den Kontext der damaligen Zeit: Aufnahmen aus dem Jahr 2002 zeigen die aufgeheizte Stimmung zur Zeit der konservativ-rechtspopulistischen CDU-Schill-Regierung, als diese den Wagenplatz Bambule räumen ließ. Ein Jahr zuvor hatte Iris P. Kontakt zur Szene aufgenommen.
Eine Debatte anregen
„Im inneren Kreis“ zeigt auch, wie aktiv der Staat durch seine Spitzel ins Private eingreift: Der Einsatz von Iris P. führte zu Spaltungen in der Szene. Während einige Aktivist*innen P. schon früh verdächtigten, Polizistin zu sein, vertrauten ihr andere. Die Ermittlerin selbst sei in Tränen ausgebrochen, als sie von dem Verdacht erfahren habe. „Für Iris brach eine Welt zusammen“, glaubte Tanja damals. Beweise gab es allerdings nicht, so wurde der Verdacht fallen gelassen. P. blieb bis zu ihrem Abtauchen 2006 in der Szene, die Vorwürfe hatten ihre Position eher gefestigt als gefährdet. Leo, ein anderer Protagonist, lebte zwölf Jahre lang mit dem falschen Schuldgefühl, Iris P. zu Unrecht verdächtigt zu haben.
Mit dem Film wollen die Regisseur*innen eine öffentliche Debatte über das umstrittene Überwachungsinstrument anregen. Das stößt auch auf Kritik: Eine Gruppe um eine Exfreundin von Iris P. mobilisiert gegen den Film. Bei Facebook und auf Flyern, die sie an die Kinos geschickt hat, wirft „Ute Müller“, wie sich die Exfreundin P.s nennt, dem Filmteam Sensationsgier und Szenefremdheit vor. Den Protagonist*innen hält sie vor, mit „unpolitischen, manipulativen und grenzüberschreitenden Filmemacher_innen“ zusammengearbeitet zu haben.
Einige der Protagonist*innen haben es sich bei der Vorpremiere in Hamburg wiederum nicht nehmen lassen, ihre Kritik an den Filmemacher*innen zu äußern. Die Zusammenarbeit sei zum Teil schwierig gewesen, klagen die Florist*innen. Einen Film über ein so sensibles Thema zu machen, ohne dass dabei Spannungen entstehen, sei unmöglich, verteidigen sich die Regisseur*innen. Einen Moment lang wird es unangenehm im Kinosaal. Jemand fordert, alle Einnahmen des Films den Betroffenen zukommen zu lassen. Der Veranstalter sagt, dass solche Filme nie Geld einbringen. Am Ende einigen sich alle, dass sich an der Debatte vor allem eins zeigt: die emotionale Verwüstung, die Spitzeleinsätze hinterlassen.