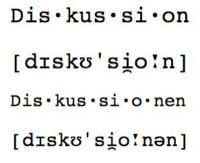Wir sind eine Gruppe aus der radikalen Linken in München, die seit
vielen Jahren besteht und in der Antiglobalisierungsbewegung und in
antimilitaristischen Bewegungen aktiv war. Die Realität der letzten
Jahre sieht allerdings etwas anders aus: Unsere Gruppe ist wesentlich
kleiner geworden, wir treffen uns weniger regelmäßig und für gemeinsame
Aktionen bleibt wegen zunehmendem Stress im kapitalistischen
(Arbeits-)Alltag wenig Zeit. Darüber hinaus erzeugen die aktuellen
gesellschaftlichen Entwicklungen bei uns Ratlosigkeit, wo man politisch
ansetzen könnte.
Vielleicht erscheint es daher etwas überraschend, dass nun gerade von
uns ein Text kommt, der versucht, einen breiteren Überblick über
gegenwärtige politische Dynamiken und ihre Wechselwirkungen zu geben.
Aber nicht trotz, sondern gerade wegen der Situation, in der wir uns
befinden, haben wir den Versuch unternommen, aktuelle gesellschaftliche
Entwicklungen und die Rolle der radikalen Linken zu analysieren, um der
verbreiteten Desorientierung und den daraus resultierenden Alternativen
der Apathie oder der Feuerwehrpolitik wenigstens ein Stück weit zu
entkommen.
Der vorliegende Text ist aus heterogenen Positionen und kontroversen
Diskussionen, die wir im Laufe des letzten Jahres geführt haben,
entstanden. Diese Skizze erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit,
kann aber vielleicht trotzdem als Ausgangspunkt für eine gemeinsame
Diskussion um Fluchtlinien einer radikalen emanzipatorischen Politik
dienen. Wir würden uns über Reaktionen, Kritik und Diskussionsbeiträge
freuen!
Do you remember global war?
Um den gegenwärtigen Zustand ansatzweise zu erfassen, ist ein Blick
zurück unumgänglich und für uns scheint es (vielleicht auch biographisch
bedingt) Sinn zu machen, bis ins Jahr 2001 zurückzugehen: Im Sommer
2001 hatte die sogenannte Antiglobalisierungsbewegung mit den Tagen von
Genua ihren Höhepunkt erreicht, als 300.000 Menschen gegen den G8-Gipfel
in der italienischen Hafenstadt auf die Straße gingen und sich
Massenproteste und militanter Widerstand auf eine Weise und in einer
Dimension verbanden, wie sie viele von uns vorher nie erlebt hatten.
Doch der kurze Sommer des antikapitalistischen Protests endete mit dem
11. September und danach brach der lange Herbst des „global war on
terrorism“ an. Genau dieses Paradigma des „globalen Krieges“ stellt
immer noch eine bestimmende Konstante unserer Gegenwart dar, die
inzwischen tief im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert ist. Hier
können nur einige wenige Aspekte des „globalen Krieges“ gestreift
werden: Die Reaktion der USA und ihrer Verbündeter auf 9/11 hat neben
spektakulären Feldzügen mit hunderttausenden Toten eine neue Form der
hybriden Kriegsführung hervorgebracht, die heute in ihrer Kombination
von Großangriff und verdeckten Operationen, Drohnenkrieg und
zivil-militärischer Zusammenarbeit den Alltag in ganzen Weltregionen
bestimmt. In Afghanistan und Irak, Jemen und Somalia, Libyen und Syrien,
Tschad, Niger und Mali, um nur einige der Schauplätze zu nennen.
Die Motive für das westliche „Eingreifen“ aufzuschlüsseln, bleibt
schwierig: Während anfangs neben der „Vergeltung“ für 9/11
kapitalistische Interessen und die neokonservative Hybris des „nation
building“ im Vordergrund standen, scheinen diese Motive „des Westens“
inzwischen eher einer Art Feuerwehr- und Killer-Logik gewichen zu sein,
der zufolge „Brandherde“ zu löschen sind und der „Feind“ nirgends vor
(präventiver) „Vergeltung“ sicher sein darf. Zugleich sind die
Schauplätze des „globalen Krieges“ immer auch Austragungsort
geostrategischer Machtkämpfe einer kaum überschaubaren Anzahl von
Akteuren, die in wechselnden Konstellationen eigene politische
Interessen durchzusetzen versuchen: Der rasche Wechsel von Konfrontation
zu Kooperation zwischen Russland und der Türkei im Hinblick auf Syrien
ist hier nur ein Beispiel.
Global war reloaded
Auf den ersten Blick hat der „global war on terrorism“ George W. Bushs
von 2001 allerdings recht wenig mit der Realität des Jahres 2017 zu tun.
Um den „globalen Krieg“ als kontinuierliches Phänomen zu begreifen,
müssen zwei Aspekte berücksichtigt werden: die Metamorphosen des
„Feindes“ und die (eng damit verbundene) Ausweitung der Kampfzonen. Im
Zuge des „globalen Krieges“ entstand mit dem ‚Islamischen Staat‘ (IS)
ein neuer politischer Akteur der Gegenwart, der den ursprünglichen Feind
„des Westens“, Al-Quaida, angesichts seiner territorialen
Machtentfaltung, seiner globalen Medienpräsenz und nicht zuletzt seiner
Attraktivität für Menschen auch in Europa, wie einen mäßig gelungenen
Prototypen wirken lässt. Zugleich sind die heutigen Kriegsschauplätze
nur begreifbar, wenn wir die Aufstände der Menschen in zahlreichen
arabischen Staaten 2011 und das weitgehende Scheitern ihrer
emanzipatorischen Ambitionen durch brutale Repression, militärische
Eskalation und ausländische Intervention mit einkalkulieren: Erst durch
das Scheitern des „arabischen Frühlings“ gerieten z.B. Libyen und Syrien
in den Sog des „globalen Krieges“.
Trotz aller Veränderungen bleiben eine Reihe von Tendenzen festzuhalten,
die den „globalen Krieg“ seit 2001 charakterisieren. Dieser Krieg
reproduziert sich selbst auf stets erhöhter Stufenleiter: Er produziert
„Feinde“, Kriegsgründe und Krieger, die zu töten und zu sterben bereit
sind. Er generiert Kriegsgesellschaften, in denen stets neue Feinde und
Krieger heranwachsen und in denen ein auf Dauer gestellter
Ausnahmezustand herrscht, der die Überwindung der Kriegslogik unendlich
erschwert und emanzipatorische Veränderung gänzlich unmöglich erscheinen
lässt.
In der aktuellen Phase des „globalen Krieges“ scheinen sich alle
düsteren Prophezeiungen seiner Apologeten zu bewahrheiten: Nach den
Anschlägen von Paris, Brüssel, Nizza und zuletzt Berlin im Dezember
2016, scheint dieser Krieg zumindest partiell tatsächlich in die
europäischen Metropolen eingezogen zu sein – nicht nur weil hier Bomben
explodieren oder LKWs in Menschengruppen rasen, sondern auch weil viele
der Attentäter in Europa aufgewachsen sind oder hier zu dem wurden, was
sie sind. Durch soziale Medien und globale Rekrutierungsstrategien ist
es dem IS gelungen, Menschen in den „westlichen“ Gesellschaften zu
mobilisieren. Angeblich haben sich bisher etwa 5000 Europäer*innen dem
IS in Syrien oder dem Irak angeschlossen, hinzu kommen viele, die das
reaktionäre Projekt des IS indirekt unterstützen oder zumindest
begrüßen.
Die gegenwärtige Phase des globalen Krieges zeichnet sich also nicht nur
durch eine Ausweitung der Kriegsgebiete aus, sondern auch durch eine
Zuspitzung der Widersprüche: In den Staaten des Westens werden heute
nicht mehr nur die Killer „des Westens“ produziert, sondern auch ihr
Pendant der Gegenseite – dem westlichen Drohnenpiloten steht der
islamistische (Selbstmord-)Attentäter gegenüber, wobei der
phänomenologische Unterschied dieser beiden Figuren vor allem darin
besteht, dass letzterer bereit ist, nicht nur Unschuldige, sondern auch
sich selbst aus dem Leben zu reißen, während ersterer aus sicherer
Distanz agiert und die Unschuldigen (meist) nicht primär anvisiert,
sondern als „Kollateralschäden“ akzeptiert.
Beide Formen der Kriegsführung ähneln sich ansonsten grundlegend: Es ist
ein immer währender Krieg, in dem man verdeckt agiert und in dem stets
aus dem Hinterhalt zugeschlagen werden kann. Es ist ein Krieg, der
keinen Unterschied macht zwischen Kämpfer*innen und Zivilist*innen, ein
Krieg, in dem die Angst der Gegenseite vor jederzeit möglicher
„Vergeltung“ ein zentrales Ziel darstellt. So ist der Ausnahmezustand
(ob offiziell wie in Frankreich oder inoffiziell wie in der BRD) der
neue Normalzustand geworden und das Leben der Menschen wird immer
stärker geprägt von Terrorangst und neuen Sicherheitsgesetzen, dauernden
Polizeirazzien und angeblich vereitelten Anschlägen und einem immer
weiter wachsenden antimuslimischem Rassismus.
Uns erscheint es heute wichtig, als radikale Linke Position zum Projekt
des IS zu beziehen, ohne dabei die globalen Machtverhältnisse und die
extreme Asymmetrie der militärischen Auseinandersetzung aus dem Blick zu
verlieren. Der IS ist ein Produkt des „globalen Krieges“, sowohl seine
Ziele, als auch seine Mittel sind extrem reaktionär. Seine Attraktivität
gerade für junge Männer hat oft wenig mit Religion und viel mit dem
Versprechen einer brutalen und sexistischen Selbstermächtigung zu tun,
die auf einem radikalen Bruch mit den Gesellschaften basiert, in denen
die potentiellen Anhänger leben. So wenig die gesellschaftlichen
Bedingungen als alleinige Erklärung oder gar Rechtfertigung für die
Taten von IS-Kämpfern herhalten können, so wenig darf der Zusammenhang
zwischen sozialer Ausgrenzung und Marginalisierung einerseits und der
Sehnsucht nach reaktionärer Selbstermächtigung andererseits ignoriert
werden. Bisher aber fehlt uns eine klare und radikale Haltung, die eine
allgemeine linke Religionskritik mit einer konkreten Praxis gegen
Fundamentalisten jeder couleur verbindet.
Der „globale Krieg“ stellt uns also vor zahlreiche Herausforderungen:
Dem Ausnahmezustand und der Kriegslogik in unseren Gesellschaften
entgegenzutreten, den IS und sein ideologisches Umfeld als Faktor nicht
nur an fernen Kriegsschauplätzen, sondern auch hierzulande einzuordnen
und zu bekämpfen. Angesichts der aktuellen Bedeutung des „globalen
Krieges“ ist es ebenso erstaunlich wie bedauerlich, dass der
zwischenzeitliche antimilitaristische Fokus von Teilen der radikalen
Linken inzwischen wieder weitgehend verloren gegangen zu sein scheint –
wenig wäre gerade nötiger, als eine klare inhaltliche Position gegen
jeden Krieg und eine Praxis, die diesem Ziel Rechnung trägt.
Vom Krieg zur Krise
Den zweiten zentralen Faktor, der unsere Gegenwart prägt, stellt neben
dem „globalen Krieg“ sicherlich die offenkundige Krise des
kapitalistischen Akkumulationsregimes seit 2007 dar. Auch hier würde
eine präzise Beschreibung der grundlegenden Sachverhalte schnell jeden
Rahmen sprengen – deshalb nur einige grobe Pinselstriche: Ausgehend von
einer Überakkumulationskrise in den 2000er Jahren bildete sich in den
USA eine gigantische Spekulationsblase auf dem Immobilienmarkt, deren
Platzen ab Herbst 2007 zu einer Bankenkrise („Lehmann Brothers“) führte,
die sich schnell ausweitete. Durch die „Rettungsaktionen“ zahlreicher
Staaten wurden und werden private Risiken sozialisiert und aus der
Bankenkrise wurde vielerorts eine „Staatsschuldenkrise“. Dieser wird in
Europa, insbesondere auf Druck Deutschlands, mit drakonischen
Austeritätsprogrammen begegnet, wodurch die Volkswirtschaften
zahlreicher Staaten vor allem des europäischen Südens in die Rezession
getrieben werden.
Die implementierten „Strukturreformen“ zerstören große Teile der
sozialen Sicherungssysteme, lassen die (Jugend-) Arbeitslosigkeit in
schwindelerregende Höhen schnellen und zwingen die betroffenen Staaten
zu radikalen Privatisierungsprogrammen, wodurch öffentlicher Besitz de
facto zwangsversteigert wird. Die fundamentale Krise des Kapitalismus
ist heute keineswegs vorüber: stetig wachsende Spekulationsblasen an den
Finanzmärkten, mangelndes realwirtschaftliches Wachstum und eine
Überakkumulationskrise, die ständig in Deflation zu münden droht,
welcher die EZB durch Minuszinsen und ein Anleihenkaufprogramm in
Billionenhöhe gegenzusteuern versucht, wodurch sie die Spekulation
abermals anheizt.
Um zu begreifen, dass die aus der Akkumulationskrise resultierende
spekulative Blasenbildung auch ohne den ganz großen Crash alltäglich auf
unsere Lebenswirklichkeit durchschlägt (und das nicht nur in den
krisengebeutelten Ländern Südeuropas), genügt ein Blick auf die
Entwicklung der Immobilienpreise in deutschen Großstädten. 15%
Preissteigerung in Städten wie Berlin und München im Jahr 2015 hat nur
bedingt etwas mit Zuzug und mangelndem (öffentlichen) Wohnungsbau zu
tun: Großanleger versuchen die offensichtlichen Risiken auf dem
Aktienmarkt durch massenhafte Immobilienkäufe im Rahmen zu halten – mit
dramatischen Folgen für alle, die zur Miete wohnen.
Die Kontinuität der Krise seit 2007 ist ein Faktum – was sich seit
Ausbruch der Krise allerdings völlig verkehrt hat, sind die politischen
Vorzeichen: Während wir 2008 über die Potentiale emanzipatorischer
Veränderung angesichts der offensichtlichen Delegitimierung des
neoliberalen Kapitalismus diskutierten, hoffen wir heute vielleicht den
einen oder anderen kleinen Kampf gegen die Durchsetzung einer
radikalisierten neoliberalen „Reformagenda“ erfolgreich zu bestreiten –
der Kapitalismus aber ist in der Offensive.
Es existiert heute kein gemeinsamer Kampf gegen die Krise, geschweige
denn gegen jenes Akkumulationsregime, das sie ausgelöst hat. Die meisten
Kämpfe finden auf lokaler, regionaler oder maximal auf nationaler Ebene
statt, von transnationaler Solidarität gegen die Austeritätsprogramme
der Troika kaum eine Spur. Als die griechische Bevölkerung nach Jahren
des Straßenprotestes versuchte, ihrer Ablehnung der Sparprogramme durch
die Wahl einer linkssozialdemokratischen Regierung („Syriza“) Ausdruck
zu verleihen, wurde diese von den großen sozialdemokratischen Parteien
und Gewerkschaften Europas derart im Regen stehen gelassen, dass sie
schließlich alle bitteren Pillen schluckte und nun jene
Austeritätsprogramme umsetzt, die zu verhindern sie angetreten war.
Damit hat nicht nur Syriza politischen Selbstmord begangen, sondern die
sozialdemokratischen Parteien und Gewerkschaften der großen europäischen
Staaten haben deutlich gemacht, dass sie nicht einmal eine graduelle
Entschärfung der neoliberalen Agenda anstreben und somit politisch
völlig obsolet sind.
Dass selbst der IWF die Austeritätsprogramme für Griechenland für nicht
zielführend hält und einen Schuldenschnitt anmahnt, macht nur noch
deutlicher, was ohnehin auf der Hand liegt: Im Fall Griechenlands ging
es immer zuerst um eine politische Machtfrage. Schäuble und Co. ging es
darum, deutlich zu machen, dass es keine Alternative zum herrschenden
Wirtschaftssystem gibt, ganz gleich, wen die Leute wählen. Damit
markiert das Scheitern der Syriza-Regierung in Griechenland aber auch
jenen Punkt, an dem die traditionellen Muster der politischen
Repräsentation im Parlamentarismus vollkommen ins Leere laufen.
Natürlich gab es in den letzten Jahren verschiedene Bewegungen in
zahlreichen Ländern, die sich explizit oder implizit auch gegen den
Kapitalismus, seine Krise und die Krisenbearbeitung der herrschenden
Eliten gestellt haben: die Platzbesetzungen in Spanien, die
Occupy-Bewegung in den USA, die Proteste gegen die weitere
„Deregulierung“ des Arbeitsmarktes in Frankreich usw. Was aus unserer
Sicht aber oft fehlte, waren Resonanzeffekte in anderen Regionen und der
explizite Versuch, auf das große Ganze ab zu zielen. Ein wesentlicher
Grund dafür war sicher der Umstand, dass zentrale politische Akteure,
die eine Transnationalisierung ermöglichen könnten, sich faktisch von
jeder Form internationaler Solidarität verabschiedet haben. Ein
europäischer Streik gegen die immer weiter voranschreitende
„Deregulierung“ des Arbeitsmarktes oder für einen europäischen
Mindestlohn ist heute – zumindest aus deutscher Sicht – eine bloße
Chimäre: „Sozialpartnerschaft“ und Standortdenken prägen die politische
Agenda der DGB-Führung. Ohne gesellschaftliche Institutionen als
Transmissionsriemen, aber sind ‚große Themen’ schwer anzugehen,
dementsprechend verlagern sich Bewegungsakteure zumeist auf kleinere,
oft lokale Konflikte, anhand derer aber wiederum Netzwerke
transnationaler Solidarität nur schwer aufgebaut werden können.
Wohl auch aufgrund mangelnder internationaler Solidarität ist der
anfangs gerade in den besonders betroffenen Ländern Südeuropas starke
Widerstand abgeebbt. Er ist von der großen politischen Bühne
verschwunden, oder aber, wie z.B. im Fall von Podemos in Spanien, so
kanalisiert worden, dass er mittelfristig in die politische Maschinerie
integriert werden kann. Ein Gefühl der Ohnmacht scheint um sich zu
greifen. Verantwortlich dafür ist eine Krise der Repräsentation:
Demonstrationen, Proteste, Riots, Wahlen – alles bleibt weitgehend
wirkungslos, was die Spardiktate betrifft.
In der Krise offenbart der neoliberale Finanzkapitalismus damit einen
seiner zentralen Wesenszüge: Er ist ein deterritorialisiertes
Regulationsregime, in dem nicht nur die „Wertschöpfungsprozesse“,
sondern auch die herrschende Klasse immer weniger in einem
nationalstaatlichen Gefüge verankert sind. Während fordistische Eliten
noch in einem hohen Maß auf nationalstaatlich organisierte Prozesse der
„Wertschöpfung“ (=Ausbeutung) und Hegemoniebildung angewiesen waren und
ein enger Nexus zwischen dem wachsenden Konsumniveau breiter
Gesellschaftsschichten und den Profiten der Kapitalist*innen bestand,
sind diese Kopplungen heute außer Kraft gesetzt.
Diese Tatsache ist zwar den meisten Menschen in Europa nicht explizit
bewusst, doch ein implizites, oft verzerrtes Bewusstsein existiert sehr
wohl und leistet oft jener Tendenz der (imaginären)
Reterritorialisierung Vorschub, die allerorts von reaktionären Kräften
betrieben wird: Stärkung der nationalen (oder regionalen) Identitäten
als Gegenmittel zum faktischen Bedeutungsverlust nationaler Räume im
Hinblick auf die wirtschaftliche, politische und soziale Regulation.
Vor dem Hintergrund der hier nur knapp umrissenen Dynamiken von Krise
und Krieg wollen wir nun auf die konkreten gesellschaftlichen
Widersprüche und Kämpfe zu sprechen kommen, die die gegenwärtige
Situation prägen: die globalen Migrationsbewegungen und die Renaissance
des Nationalismus in Europa und den USA.
Von der Krise zum Rechtsruck: ‚Brexit‘ und Trump
Mit Großbritannien hat sich eines der wirtschaftlich und politisch
wichtigsten Länder aus der europäischen Gemeinschaft verabschiedet. Der
Ausgang des Brexit-Referendums lief dabei gegen die herrschende
kapitalistische Vernunft: Der globale Finanzplatz London droht durch den
EU-Austritt schweren Schaden zu nehmen, an den Finanzmärkten kam es in
Folge des Brexits zu harten Einbrüchen und der Wert des Pfunds fiel auf
ein Rekordtief. All dies war völlig vorhersehbar und trotzdem nicht
entscheidend für den Ausgang des Referendums.
Offensichtlich wird die EU immer weniger mit dem Versprechen wachsenden
Wohlstands und einer Angleichung der ökonomischen und sozialen
Verhältnisse assoziiert. So haben die nostalgische Sehnsucht nach der
„guten alten Zeit“ des fordistischen Wohlfahrtsstaates sowie die
Ressentiments gegenüber der EU und der mit ihr verbundenen Einwanderung,
die von den Brexit-Apologeten zum Sündenbock für das gescheiterte
neoliberale Modell in Großbritannien gemacht wurde, gesiegt. Mit dem
britischen Votum für den EU-Austritt triumphiert der Nationalismus
gegenüber einer Globalisierung neoliberaler Prägung.
Die Hoffnung auf eine Restauration des nationalen Wohlfahrtsstaates, die
manche Austrittsbefürworter getrieben haben mag, bleibt angesichts der
transnational agierenden Kapital- und Finanzmarktakteure und der
wirtschaftsliberalen Agenda der britischen Eliten utopisch: Die
britische Regierung versucht bereits jetzt durch Steuerdumping einer
drohenden Kapitalflucht zu begegnen.
Während die politische Klasse Europas noch schockiert nach London
starrte, ereignete sich jenseits des Atlantiks ein politisches Desaster,
das noch weit höhere Wellen schlägt: Donald Trump zog ins Weiße Haus
ein. Ohne hier genauer auf die Gründe für Trumps Wahlsieg und seine
ebenso reaktionäre wie gefährliche Politik eingehen zu können, liegt
eines auf der Hand: Der Brexit und die Wahl Trumps folgen dem gleichen
Muster. Beide stehen für die Aufkündigung des herrschenden politischen
Konsenses, der „den Westen“ in den letzten Jahrzehnten prägte:
Neoliberalismus, Freihandel und relativer gesellschaftlicher
Liberalismus werden durch ein reaktionäres Projekt ersetzt, das auf
Nationalismus, partiellen Protektionismus und gesellschaftlichen
Rollback setzt.
Trump hat schnell klar gemacht, wie ernst er die Rhetorik seines
Wahlkampfes meinte: Seine innenpolitische Agenda vom geplanten Mauerbau
an der Grenze zu Mexiko über Abschiebungen „illegaler“ Migrant*innen
bis zum Einreiseverbot für Muslime schafft ein gesellschaftliches Klima
des offenen Rassismus. Während innenpolitisch also eine Verwandtschaft
zwischen Trumps Programm und dem europäischer Neonationalisten wie Orban
konstatiert werden könnte, sind die außenpolitischen Auswirkungen der
Präsidentschaft Trumps noch kaum abschätzbar: Angesichts
apokalyptisch-faschistoider Berater à la Bannon erscheint jede Form
außenpolitischer Eskalation, bis hin zu einem Krieg gegen China denkbar.
Die deutsche Regierung nimmt das Gepolter aus Washington zum Anlass, um
eine radikale Erhöhung der Militärausgaben zu fordern; mit dem Argument,
nur so seien die USA dauerhaft auf ihre „Solidarität“ in der NATO zu
verpflichten. Wenn es überhaupt ein außenpolitisches Problem mit Trump
gibt, dann nur, weil er aufgrund seiner angeblichen Nähe zu Putin
Russland gegenüber nicht zu einer harten Haltung in der Lage sei.
Nur eine Fraktion der herrschenden Klasse scheint uneingeschränkt
optimistisch in die Zukunft zu blicken – die US-(Finanz-)Wirtschaft: Der
Dow Jones feiert ein Allzeithoch nach dem anderen. Milliardäre und
ehemalige Goldman-Sachs-Banker in Kabinett und Beraterstab werden u.a.
mit Steuersenkungen dafür sorgen, dass sich auch im neuen
Regulationsregime Profit erwirtschaften lässt; durch die völlige
„Privatisierung“ der Bildung, eine Förderung fossiler Energieträger oder
eben durch den Bau einer 3000 Kilometer langen Mauer.
Ähnliche reaktionäre Tendenzen wie in Großbritannien und den USA
zeichnen sich u.a. in Frankreich, den Niederlanden, Österreich und
zahlreichen Staaten Osteuropas ab, so dass ohne Zweifel von einer
politischen Zeitenwende gesprochen werden kann. Wer dachte, die
Freihandelsdoktrin der letzten Jahrzehnte sei innerhalb des
kapitalistischen Systems inzwischen alternativlos, sieht sich eines
Besseren belehrt: Das Dogma der letzten Jahrzehnte lautete TINA („there
is no alternative“), das neue lautet gewissermaßen „there is an
alternative – and it’s even worse!“
Angesichts dieser bedrohlichen Welle vollzieht sich gerade eine paradoxe
Verschiebung der Perspektiven: Das bisher von linken Kräften politisch
bekämpfte Projekt des Neoliberalismus, das gerade vor dem Hintergrund
der aktuellen ökonomischen Krise und der immer deutlicher werdenden
ökologischen Krise jeden letzten Rest politischer Legitimität verspielt
zu haben schien, erfährt angesichts von Trump und Co. eine
Relegitimierung. Die Tatsache, dass gerade die verheerenden
gesellschaftlichen Konsequenzen von zwei bzw. drei Jahrzehnten
Neoliberalismus den Nährboden für den reaktionären Rollback bereitet
haben, dem wir uns zur Zeit gegenübersehen, droht in den Hintergrund zu
geraten.
Wir sind als Linke nicht gewillt, zwischen neoliberaler Pest und
nationalistischer Cholera zu wählen, sondern wir wollen eine völlig
andere Gesellschaft. Wir müssen versuchen, uns von den jüngsten Siegen
des Neonationalismus nicht den Blick auf jene Tatsache verstellen zu
lassen, die ihnen zugrunde liegt: die umfassende Legitimationskrise des
kapitalistischen Akkumulationsregimes der letzten Jahrzehnte und die
daraus resultierende Repräsentationskrise des politischen Systems. Dass
diese Repräsentationskrise z.Z. nur reaktionären Projekten zum Erfolg
verhilft, ist auch Ausdruck der eklatanten politischen Schwäche der
institutionellen Linken. Für uns als radikale Linke sollte beides, die
Repräsentationskrise des bestehenden Systems und das Vakuum auf der
Linken, Ansporn sein politisch zu intervenieren.
Aufrüsten der Festung Europa
Nicht nur der Brexit machte die schwindende Bindekraft der EU zuletzt
deutlich: Auch in der sogenannten ‚Flüchtlingskrise‘ konnten sich die
EU-Staaten lange nicht auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen.
Während das sogenannte ‚Dublin-System‘ unter dem Druck der
Migrationsbewegungen zwischenzeitlich faktisch zusammengebrochen war,
gelang es der EU nicht, sich auf ein neues Verfahren der Aufnahme und
Verteilung der geflüchteten Menschen zu einigen. Auch die auf die
Flüchtlingsbewegungen folgende Abschottung der Grenzen entlang der
Balkanroute setzte sich zunächst in Form nationaler Alleingänge durch.
Erst mit dem ‚Türkei-Deal‘ gelang es der EU die Initiative in der
„Flüchtlingsabwehr“ wieder zurück zu gewinnen. Für die „Sicherung“ der
europäischen Außengrenzen und die Internierung der Geflüchteten in
großen Auffanglagern an der syrisch-türkischen Grenze zahlt die EU der
Türkei bis zu 6 Milliarden Euro. Außerdem wurden der türkischen
Regierung zunächst die Aufhebung der Visapflicht und Fortschritte bei
den EU-Beitrittsverhandlungen in Aussicht gestellt. Alle Geflüchteten,
die es auf eigene Faust bis nach Griechenland schaffen, sollen umgehend
wieder zurück geschoben werden. Seit Abschluss des ‚EU-Türkei-Deals‘
schweigen die europäischen Regierungen zu allen Verletzungen der
Menschenrechte und autoritären Entwicklungen im Land: Das autoritäre
AKP-Regime verwandelt sich unter der despotischen Führung von Erdoğan in
eine brutale Diktatur, die den Militärregimes in der jüngsten
türkischen Vergangenheit in nichts nachsteht.
Durch den ‚Türkei-Deal‘ werden die flüchtenden Menschen gezwungen, sich
auf immer gefährlichere und teurere Passagen zu begeben. Die 2016 noch
einmal stark gestiegene Zahl der Toten im Mittelmeer ist eine direkte
Konsequenz der europäischen Abschottungspolitik. Doch auch die
Abdrängung der Migrationsrouten ins Bürgerkriegsland Libyen mitsamt der
hochgefährlichen anschließenden Bootspassage durch das zentrale
Mittelmeer scheint den EU-Strategen als Abschreckung nicht ausreichend:
Als nächstes soll ein Deal mit Libyen ähnlich dem Türkei-Deal her,
ungeachtet der Tatsache, dass das Land vom Bürgerkrieg zerrissen ist und
keine der konkurrierenden ‚Regierungen‘ überhaupt das gesamte
Territorium kontrolliert. Die EU wird hier wohl „nation building“ im
Zeichen der „Flüchtlingsabwehr“ betreiben. Wer es trotz allem hierher
schafft, soll dann möglichst bald wieder abgeschoben werden, auch wenn –
wie in Afghanistan – im Herkunftsland ein Krieg tobt, der jedes Jahr
mehr Zivilist*innen das Leben kostet.
Nach dem Sommer der Migration
Der „globale Krieg“ brach nicht nur punktuell in Gestalt der jüngsten
Anschläge ins Bewusstsein der Menschen in Europa, weitaus nachhaltiger
prägte er das Jahr 2015 auf indirektem Weg durch die
Migrationsbewegungen: Millionen von Menschen sahen sich gezwungen ihre
Herkunftsländer zu verlassen und einige von ihnen versuchten sich nach
Europa durch zu schlagen, in der Hoffnung dort Schutz und die Chance auf
ein Leben in Würde zu finden. Es ist kein Zufall, dass unter den
Herkunftsländern der Geflüchteten, die letztes Jahr nach Deutschland
kamen, Syrien, Afghanistan und Irak ganz vorne rangierten. Alle drei
Länder sind Schauplätze des „globalen Krieges gegen den Terror“.
Auf eine geopolitische Analyse der genannten Konflikte soll hier
verzichtet werden. Uns scheint es an dieser Stelle wichtiger zu sein,
nach den Perspektiven für eine antirassistische Politik zu fragen.
Nachdem das massenhafte Sterben an den EU-Außengrenzen in der
Vergangenheit jenseits antirassistischer und linker Kreise nur für wenig
Empörung und Protest gesorgt hatte, veränderte sich der herrschende
Diskurs in der BRD im Sommer 2015. Viel mehr Refugees als in den letzten
Jahren versuchten nach Deutschland zu gelangen und anders als viele von
uns erwartet hätten, beteiligten sich tausende Menschen spontan an
Begrüßungs- und Hilfsaktionen. So erfreulich dies war, so heuchlerisch
war die offizielle Begleitmusik von Merkels „Wir schaffen das“ über den
omnipräsenten Neologismus der „Willkommenskultur“ bis zu Gaucks
unerträglichem Gewäsch vom „hellen Gesicht Deutschlands“.
Linke Versuche in der Welle der Hilfsbereitschaft antirassistischen
Forderungen Nachdruck zu verleihen, entpuppten sich bald als schwierig:
Viele wollten helfen, waren aber nicht für ein weitergehendes
politisches Handeln zu gewinnen. Helfer*innenkreise und antirassistische
Gruppen interagierten nur punktuell, Radikalisierungsprozesse der
Helfer*innen angesichts der offensichtlichen Unmenschlichkeiten der
deutschen Flüchtlingspolitik blieben lange Zeit die Ausnahme. Ob sich
dies nun angesichts der Abschiebeoffensive ändern wird, bleibt
abzuwarten, zumindest scheint es in vielen Helfer*innenkreisen zu
rumoren.
Auch der andere logisch erscheinende politische Schulterschluss, nämlich
der mit Menschen, die als Refugees oder Arbeitsmigrant*innen nach
Deutschland gekommen sind, scheint sich bisher nur partiell
einzustellen. Als kollektives politisches Subjekt wurden die Flüchtenden
vor allem dort medial sichtbar, wo ihnen auf ihrem Weg die Weiterreise
verwehrt wird (Calais, Idomeni usw.). Am Ziel ihrer Reise angekommen,
verwandelt sich das politische Agieren oft in Praktiken des
Alltagswiderstandes und verschwindet so aus dem medialen Fokus. Auch
erschweren der prekäre Aufenthaltsstatus, die Alltagsprobleme in den
Erstaufnahmelagern und Gemeinschaftsunterkünften und das deutsche
Asylrecht, mit seiner strategischen Spaltung der Geflüchteten in
möglichst viele Untergruppen mit unterschiedlichem Status, Prozesse der
politischen Selbstermächtigung.
Dennoch gibt es einige ermutigende Beispiele für den Versuch von
Migrant*innen und linken Gruppen gemeinsam für elementare (soziale)
Rechte zu kämpfen, wie zum Beispiel die Protestcamps und Hungerstreiks
von Geflüchteten in der Münchener Innenstadt, die eindrucksvollen
Protestmärsche Geflüchteter, das Protestcamp am Oranienburger Platz in
Berlin, die antirassistischen Aktionstage gegen das zentrale
Abschiebelager in Bamberg im Sommer 2016 und die jüngsten
Demonstrationen gegen Abschiebungen nach Afghanistan, sind wichtige
Beispiele für gemeinsame Kämpfe von Refugees und einheimischen
Aktivist*innen. Allerdings fehlt bei allen diesen Kämpfen die breite
gesellschaftliche Solidarisierung, die im Herbst 2015 angesichts der
Ankunft von zehntausenden Geflüchteten am Münchener Bahnhof so
eindrucksvoll zum Ausdruck kam. Trotzdem: Refugees sind durch ihre
Kämpfe in den letzten Jahren auch hier zu einer wichtigen politischen
Bewegung geworden, die sich nicht nur an antirassistischen Kämpfen
beteiligt.
Migration und Klassengesellschaft
Jenseits der politischen Kämpfe, die gemeinsam mit Geflüchteten,
Migrant*innen und all jenen geführt werden müssen, die bereit sind sie
zu unterstützen, stellt sich die Frage, welche längerfristigen
gesellschaftlichen Entwicklungen sich im Kontext von Migration und
Sozialabbau absehen lassen: Auch in Deutschland erscheint eine weitere
Unterschichtung der Gesellschaft mit den dazugehörigen Tendenzen der
Verelendung wahrscheinlich. Neben Hartz IV-Bezieher*innen,
Aufstocker*innen, prekär Beschäftigten und einer rapide zunehmenden Zahl
von „Altersarmen“, werden zunehmend Menschen treten, die als
„Ausreisepflichtige“ oder „EU-Ausländer“ keinerlei Anspruch auf
Sozialleistungen und keine Chance auf einen regulären Job haben. Es
drohen Szenarien, wie sie bis vor kurzem z.B. aus Italien bekannt waren,
wo hunderte obdachlose Geflüchtete rund um die Bahnhöfe großer Städte
auf der Straße schlafen oder in leerstehende Gebäude einziehen, um in
regelmäßigen Abständen vertrieben, aber eben nicht untergebracht zu
werden.
Die Unterschichtung der Gesellschaft bietet aus Sicht des deutschen
Kapitals mit Sicherheit einige Vorzüge. Die Forderung deutscher
Arbeitgeberverbände nach ‚Lockerung’ des Mindestlohns für Geflüchtete
ist nur ein Beispiel. Die sozialpolitische Kehrseite der Medaille, die
um sich greifende Verelendung, ist aus Sicht der kapitalbesitzenden
Klasse wenig wünschenswert, da der relative soziale Friede hierzulande
eine wesentliche Grundlage der Herrschaft eben dieser Klasse darstellt.
Diese Ruhe wird man sich nicht nehmen lassen wollen und so droht auch
vor dem Hintergrund von Illegalisierung, Prekarisierung und Sozialabbau
eine ähnliche Entwicklung wie jene, die der „globale Krieg“ katalysiert.
Der Ausnahmezustand wird also einen Doppelcharakter annehmen, da die
Innenstädte nicht nur eine Front im „globalen Krieg gegen den Terror“,
sondern auch im nationalen/lokalen Krieg gegen die „gefährlichen
Klassen“ sein werden – den ‚südosteuropäischen Einbrecherbanden‘ zum
Beispiel, vor denen Bremens Polizeichef 2016 warnte.
Die Anschläge von Paris, Brüssel, Nizza und Berlin, die Übergriffe der
Kölner Silvesternacht und die tägliche rassistische Berichterstattung
haben im hegemonialen Diskurs einen spezifischen ‚Tätertypus’ entstehen
lassen: der junge muslimische Mann, als potentieller Klein- und
Gewaltkrimineller, Vergewaltiger und Terrorist. Hier drohen
Kriegsrhetorik, Terrorangst, die Zerschlagung sozialstaatlicher
Sicherungssysteme und der wachsende (antimuslimische) Rassismus, eben
jene Täter real hervorzubringen, vor denen dann Sonderkommandos und
Sondergesetze „Schutz“ versprechen.
Die AfD als Krisenprofiteur
Das politische Kapital aus der Zuspitzung der verschiedenen
Krisenprozesse schlägt bisher die radikale Rechte: Spätestens mit den
Wahlerfolgen der AfD in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und
Baden-Würtemberg im März 2016 sehen wir uns einem gesellschaftlichen
Rechtsruck gegenüber, der in den Pegida-Demonstrationen Ende 2014 seinen
Anfang genommen hat. Aus der Kleinpartei mit neoliberaler und
erzkonservativer Agenda, ist innerhalb eines Jahres eine Partei
geworden, die sich als Sammlungsbewegung am rechten Rand des
Parteienspektrums zu etablieren scheint und die Rolle des FN in
Frankreich oder der FPÖ in Österreich übernehmen könnte. Mit einer
Mischung aus völkischem Nationalismus, Islamophobie, Wertkonservatismus
und extremem Neoliberalismus kann die AfD sowohl bei den gutbürgerlichen
Sozialrassisten punkten, die vor ein paar Jahren Sarazins Publikum
bildeten, als auch bei Teilen der Deklassierten und Prekären,
beziehungsweise jenen, die dieses Schicksal auf sich zukommen sehen.
So ist es der AfD längst gelungen, weit über das klassisch
rechtsradikale Lager hinaus breite Schichten der Bevölkerung unter ihrem
Dach zu sammeln und für ihr reaktionäres Projekt zu mobilisieren. Die
AfD vereint ein breites gesellschaftliches Spektrum von
fundamentalistischen Christen, über konservative Professoren und
Publizisten, reaktionäre Teile des Adels, mittelständische Unternehmen
und Familienbetriebe, weiße Facharbeiter*innen und
Kleingewerbetreibende, bis hin zu prekären Niedriglöhner*innen und
Hartz-IV-Empfänger*innen.
Erstaunlich ist, dass es der AfD trotz ihrer offen neoliberalen Agenda
gelingt, sowohl unter Gewerkschaftsmitgliedern als auch in armen
Stadtteilen überproportional viele Wähler*innenstimmen zu holen. So hat
die AfD in Baden-Württemberg mit einem Anteil von 30 Prozent der Stimmen
von Arbeitnehmer*innen die SPD als ‚Arbeiterpartei‘ weit hinter sich
gelassen. Die inhaltlich stark neoliberal geprägte Partei schafft es
also, sich auch als soziale Alternative zu den etablierten Parteien zu
präsentieren und so u.a. das Vakuum zu füllen, das der Niedergang der
SPD hinterlassen hat.
Doch die AfD ist nicht nur eine Wahl-, sondern auch eine
Bewegungspartei: Mit Pegida, den Demos für Alle, den
Tausend-Kreuze-Märschen und den zahlreichen lokalen Ausschreitungen
gegen Flüchtlingsunterkünfte, existiert eine vielfältige soziale
Bewegung von rechts, die der AfD als Resonanzraum und
Mobilisierungspotenzial dient.
Auf dem politischen Parkett gelingt es der AfD erfolgreich mit einer
Strategie des kalkulierten Tabubruchs den politischen Diskurs immer
weiter nach rechts zu verschieben. Nach jeder krassen Ansage einer
AfD-Protagonist*in in den Medien – Schießbefehl an der Grenze,
Rehabilitierung des Begriffs „völkisch“, Wende der Erinnerungspolitik um
180 Grad usw. – erfolgt eine partielle Korrektur durch eine andere
AfD-Politiker*in, jedoch ohne tatsächliche Distanzierung, um dann wieder
gemeinsam das neu eröffnete diskursive Terrain zu besetzen. Einen
negativen Einfluss auf die Wählergunst haben die zahlreichen mit der
Partei verbundenen politischen Skandale und internen Konflikte bisher
nicht: Die AfD scheint eher wegen als trotz ihrer konsequenten
Radikalisierung so erfolgreich zu sein.
Die Reaktionen von Seiten der Sozialdemokratie, der Gewerkschaften und
der Partei ‚Die Linke‘ auf diesen gefährlichen Trend schwanken bisher
zwischen Hilflosigkeit und Anbiederung an die verlorene Klientel. Anders
die CSU: Sie liefert sich in Sachen Flüchtlingspolitik einen Wettstreit
mit der AfD um die Enttabuisierung rechtsextremer Positionen. Die
Verbreitung rassistischer und nationalistischer Rhetorik im etablierten
politischen Diskurs, ist ein weiterer Baustein auf dem Weg zur
Normalisierung des „Rechtsrucks“. So bleibt die angebliche
„Flüchtlingskrise“ trotz stark sinkender Flüchtlingszahlen immer noch
das alles dominierende politische Konfliktthema. Der AfD ist es
gelungen, das bisherige politische Parteienspektrum aufzubrechen und die
Krise der ehemaligen „Volksparteien“ dramatisch zu verschärfen.
Radikale Linke waren bisher nicht dazu in der Lage, auf diese
Entwicklung eine adäquate Antwort zu geben: Klassische Antifa-Strategien
im Umgang mit dem neuen Rechtspopulismus, die vor allem auf die
Recherche und Skandalisierung von personellen Überschneidungen und
Querverbindungen ins offen neonazistische Spektrum setzen, bleiben
weitgehend wirkungslos. Kampagnen wie ‚Nationalismus ist keine
Alternative‘ und die Mobilisierungen gegen AfD-Parteitage in Stuttgart
oder in Werl/NRW entwickeln wenig Ausstrahlungskraft über die radikale
Linke hinaus.
Notwendig erscheint uns eine offensive und möglichst breit getragene
gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der AfD als Motor und
wirkmächtigstem Ausdruck des aktuellen rechten Projekts. Um die soziale
Selbstbemäntelung der Partei – gemeinsam mit ihrem Nationalismus,
Rassismus, Antifeminismus und Antisemitismus – anzugreifen, erscheint es
notwendig, die soziale Frage von links wieder in den Fokus unserer
Politik zu rücken und mit den Fragen von Migration und „globalem Krieg“
zu koppeln. Angesichts der weiter bestehenden Krise des Kapitalismus
und der politischen Repräsentation sowie der reaktionären
gesellschaftlichen Tendenzen finden wir es wichtig, überzeugende eigene
Inhalte formulieren und konkrete soziale Alternativen entwickeln.
Was tun?
Die gegenwärtige Orientierungslosigkeit und Marginalität der radikalen
Linken hat zahlreiche Ursachen: Da ist zum einen der sich immer weiter
steigernde Verwertungsdruck, der zu wachsendem Stress (z.B. im Studium)
und Prekarität führt, so dass vielen schlicht die Zeit fehlt, sich
politisch zu engagieren. Zugleich verstärkt der Neoliberalismus die
Individualisierung und untergräbt die Bereitschaft zum kollektiven
Handeln.
Allerdings ist es nicht nur die neoliberale Subjektivität, die
kollektives politisches Handeln marginalisiert, es ist auch die Tendenz
in der deutschen radikalen Linken Alltagsprobleme als individuelle
Probleme zu begreifen und sich so zwar einen theoretischen
Antikapitalismus auf die Fahnen zu schreiben, aber diesen kaum in
konkrete Kämpfe gegen die kapitalistischen Zumutungen im hier und jetzt
zu übersetzen. Im Gegenteil: Oft werden konkrete (z.B.
gewerkschaftliche) Auseinandersetzungen als Ausdruck reformistischer
Realpolitik belächelt, die das große Ganze ohnehin nicht ändern könnten –
ganz so als ob die faktische Passivität diesen Auseinandersetzungen
vorzuziehen sei, da so zumindest die theoretischen Ideale nicht in
Mitleidenschaft gezogen würden. Diese Form der Selbstreferenzialität
erscheint uns in vielen anderen europäischen Ländern weit weniger
verbreitet und eine wesentliche Blockade für eine radikale Linke in der
BRD, bei dem Versuch wieder gesellschaftliche Relevanz zu erlangen.
Zuletzt fehlte es uns zudem oft an Resonanzräumen: Entweder die radikale
Linke dominierte eigene (meist recht überschaubare) Kampagnen und blieb
dann weitgehend unter sich (wie z.B. bei der Mobilisierung gegen den
AFD-Parteitag in Stuttgart), oder aber andere politische Kräfte
initiierten Kampagnen und die radikale Linke blieb vollkommen unsichtbar
(wie z.B. bei den Anti-TTIP/CETA-Protesten). Besonders deutlich wurden
die gegenwärtigen Probleme in Sachen Bündnispolitik anlässlich der
Proteste gegen den G7 2015 in Garmisch: Das zunächst von relativ
radikalen Kräften geprägte Bündnis wurde von Campact gespalten, um
Zeitpunkt, Ort und Charakter des Protests eigenständig bestimmen zu
können. Radikale Kräfte im Bündnis waren zurecht empört, was aber wenig
half, zumal Campact etwa 10 Mal so viele Leute nach München
mobilisierte, wie die radikalen Kräfte nach Garmisch. In Zeiten von
Profi-Campaigner*innen (nicht selten prekarisierte Genoss*innen)
scheinen unsere traditionellen Vorstellungen von Bündnispolitik nicht
mehr richtig zu greifen.
Der Mangel an „echter“ – sprich: produktiv-konfliktgeladener –
Zusammenarbeit über Spektrengrenzen hinweg wird ergänzt durch das
weitgehende Fehlen internationaler Kooperation. Die Versuche
internationaler Kampagnen und Mobilisierungen blieben zuletzt von sehr
begrenztem Erfolg: Blockupy Frankfurt hat zwar als Event funktioniert,
weil v.a. auch mit militanten Aktionsformen ein Zeichen gesetzt wurde,
allerdings blieben die beteiligten internationalen Netzwerke sehr
überschaubar und somit auch die aus den Ereignissen resultierende
Dynamik sehr begrenzt.
Um einen Weg aus unserer derzeit marginalen Position zu finden, halten
wir es für zentral die soziale Frage wieder ins Zentrum unseres Handelns
zu rücken. Das heißt zum einen die Dinge, die uns direkt und alltäglich
betreffen, wieder verstärkt zum Gegenstand unserer Politik zu machen:
Gentrifizierung und Verdrängung in unseren Stadtteilen, Prekarisierung,
Arbeitshetze und Lohndumping an unseren Arbeitsplätzen oder
Maßnahmenterror und Kürzungen auf ALG II, Altersarmut als
Zukunftsperspektive für die Bevölkerungsmehrheit usw. Die an all diesen
Punkten zu entwickelnden Kämpfe werden nicht in jedem Fall höchsten
revolutionären Ansprüchen gerecht werden, sie werden zu ‚lokal‘, zu
‚reformistisch‘ zu sehr geprägt von der minimalistischen Agenda
potentieller Bündnispartner wie Gewerkschaften, Mietervereine o.ä. sein.
Dennoch tun genau diese Auseinandersetzungen Not, wenn die radikale
Linke nicht zum jugendkulturellen Nischenphänomen werden will, das
einzig durch seinen – allerdings sehr wichtigen – antifaschistischen
Aktivismus politisches Profil gewinnt.
Dabei gilt es bei aller Bündnisfähigkeit und Offenheit gegenüber
moderaten Kräften die eigene Radikalität nicht aufzugeben: Eine
(post-)autonome Linke als integraler Bestandteil und radikaler Flügel
einer breiten sozialen Bewegung – dieses Ideal sollten wir nicht
aufgeben, auch wenn es derzeit scheint, als ob uns nicht nur die Stärke,
sondern auch die soziale Bewegung insgesamt fehlt.
Die soziale Fragen ins Zentrum rücken heißt aber auch die sich
verschärfenden sozialen Widersprüche in jenen Politikfeldern in den
Blick zu nehmen, die wir gezwungenermaßen weiterhin beackern werden: Die
AfD ist eben nicht nur als rassistisches, nationalistisches und
antifeministisches Projekt zu bekämpfen, sondern verstärkt auch als
autoritäre Spielart der kapitalistischen Vergesellschaftung. Die
Deklassierten unter den Wählern der AfD haben ganz offensichtlich viel
reaktionäre Scheiße in ihren Köpfen, doch zwei Facetten ihrer Weltsicht
sind nicht gänzlich von der Hand zu weisen: Die soziale Schere geht
immer weiter auf und weder die etablierten Parteien noch die Medien oder
die zentralen Akteure der Zivilgesellschaft repräsentieren bzw.
artikulieren das (ebenso berechtigte wie unreflektierte) Gefühl
wachsender Teile der Bevölkerung beschissen zu werden. Dass gerade eine
Partei neoliberaler Hardliner zum Artikulationsorgan dieses Gefühls
wird, ist eine Absurdität und muss als solche thematisiert werden.
Wollen wir die soziale Frage aber zu einem wesentlichen Aspekt unseres
Kampfes gegen Rechts machen, stellt sich die Frage, wer hier ein
geeigneter Bündnispartner ist: SPD und Grüne mögen gegen den völkischen
Rassismus der AfD sein, sozialpolitisch sind sie aber für vieles von dem
verantwortlich, woraus die AfD jetzt Kapital schlägt.
Wir müssen versuchen, an neuralgischen Punkten deutlich zu machen, wie
die verschiedenen Formen der Ausbeutung, Unterdrückung und Ausgrenzung
verschränkt sind, und dieses Bewusstsein zum Ausgangspunkt eines
gemeinsamen Kampfes um soziale Rechte machen: Fortschreitende
Gentrifizierung und die Verdrängung der bisherigen Bewohner*innen eines
Stadtteils kann z.B. verknüpft werden mit dem Kampf migrantischer
Tagelöhner*innen um Wohnraum und dem Kampf von Geflüchteten gegen ein
Lagersystem, das jeder Vorstellung eines selbstbestimmten Lebens
diametral entgegensteht. Das Ziel ist ein gemeinsames: Wohnraum für
Alle! Wir finden es wichtig, dass sich derlei lokale Kämpfe in eine
größere, internationale Bewegung einbinden, sonst bleiben sie punktuell
und ohne eine radikale Perspektive.
Genau solche Formen internationaler, spektrenübergreifender
Zusammenarbeit wird es brauchen, wenn wir jener Tendenz begegnen wollen,
die sich derzeit überall in Europa abzeichnet: ein politisches Feld,
das durch die Opposition von elitärem neoliberal-aufgeklärtem Mainstream
und erstarkendem pseudo-antielitärem Nationalismus geprägt ist und in
dem links des Neoliberalismus ein Vakuum klafft. Die radikale Rechte
repräsentiert wachsende Teile der subalternen Klassen: Die einst von
Gewerkschaften und linken Parteien mit geschaffene und repräsentierte
Klassenidentität ist deren Transformation zu „New Labour“ zum Opfer
gefallen und allzu oft durch einen Rückgriff auf nationalistische und
rassistische Identifikationsmuster ersetzt worden.
Wir stehen also vor einem Paradox: Während die Krise des globalen
Kapitalismus seit 2007 und die offensichtliche Krise der politischen
Repräsentation in Europa und den USA, die sich in dem weitgehenden
Vakuum links des Neoliberalismus manifestiert, eigentlich ein idealer
Ausgangspunkt für linke Bewegungen sein müsste, erscheinen diese zu sehr
in Abwehrkämpfen verfangen und von sich überschlagenden
Negativentwicklungen desorientiert. Als ersten Schritt hin zu mehr
gesellschaftlicher Relevanz sollten wir als radikale Linke unser
Auftreten überdenken: Statt Szeneritualen, Verbalradikalismus und
jugendkulturell geprägter Selbstdarstellung geht es darum, einen
Politikstil entwickeln, der Offenheit für alle Interessierten,
Bereitschaft zur Diskussion, aber auch Durchsetzungsfähigkeit
signalisiert, wo es uns wichtig ist.
Grundlegend ändern wird sich die Situation allerdings erst, wenn ein
europäisches (und globales) linkes Projekt erkennbar wird, das eine
konkrete Alternative zum neoliberalen Projekt EU entwirft – und zwar
nicht in konstruktivem Dialog um kosmetische Veränderungen, sondern in
radikaler Konfrontation. Der Blick zurück auf die
Antiglobalisierungsbewegung kann hierbei durchaus sinnvoll sein, nicht
um Vergangenes zu glorifizieren, sondern um an die Stärken des letzten
transnationalen Bewegungszyklus in Europa, mit seinen Sozialforen und
Gipfelprotesten anzuknüpfen und dabei die alten Fehler nicht zu
wiederholen.
Mail: akg11@riseup.net