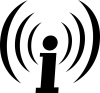Es ist 12 Uhr Mittag, und im „Oldie-Eck“ an der Soldiner Straße wird das erste Bier serviert. Es kommt in einer kleinen Flasche Schultheiß, und die wirkt geradezu winzig in den Händen des Mannes, der gleich davon trinkt. Manfred, so nennen wir ihn mal, ist 70 Jahre, hat breite Schultern, tätowierte Unterarme, einen Kinnbart und lebt seit 20 Jahren in dem Weddinger Kiez.
Früher, so sagt er, habe er in „Stresslokalen“ gearbeitet. „Ich habe Leute rausgeschmissen, die gestört haben“, präzisiert er dann. Doch die Zeiten sind vorbei – Rollator und die Lungenkrankheit COPD verändern auch das härteste Leben, nun gönnt sich Manfred im Oldies gern mal eine Verschnaufpause.
Tränengas und Sprechchöre
Von seinem Platz vor dem Lokal kann der Senior geradewegs auf den Spielplatz an der Kreuzung Koloniestraße blicken, wo es am Montagabend zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Polizisten und etwa 70 Anwohnern gekommen ist. Laut Polizeibericht ging es zunächst um einen elfjährigen Intensivtäter, dann gerieten Polizisten und Anwohner aneinander, die Polizei setzte Tränengas ein, die Menge skandierte „Haut ab, das ist unsere Straße“. Straßenkampf im Soldiner Kiez? Oder Konflikte zwischen Polizei und arabischen Großfamilien?
Fakten über den Soldiner Kiez gibt es zuhauf, und sie belegen es gleich mehrfach: Das Viertel an der Grenze zum Bezirk Pankow gehört in Berlin zu den Schlusslichtern. Von den 18.000 Einwohnern (Stand 2015) lebt jeder zweite von staatlicher Unterstützung. Die Arbeitslosenquote beträgt fast 15 Prozent, zwei von drei Bewohnern haben einen Migrationshintergrund. Ebenso viele Kinder wachsen in Armut auf. Das Durchschnittsalter liegt bei 36, das ist extrem jung für Berlin. In Fachkreisen werden Viertel wie der Soldiner Kiez als „Integrationsschleusen“ bezeichnet: Wer wenig Geld hat und neu in Berlin ankommt, landet hier – und wer es sich leisten kann, zieht wieder weg. Entsprechend hoch ist die Fluktuation, entsprechend viele Sprachen hört man im Viertel. 2014 kam dann noch ein Flüchtlingsheim dazu, in einer ausgedienten Schule.
Svenja Wagner kann sich noch gut an den Tag erinnern, als die Pläne zum Heim bekanntwurden. „Am nächsten Tag stand ein Mann bei uns im Büro, und ich war sicher, dass er sich beschweren will. Stattdessen sagte er: Wie kann ich helfen?“ So etwas sei typisch für das Viertel. „Es gibt hier einen großen nachbarschaftlichen Zusammenhalt“, sagt sie. Wagner hat die Veränderungen im Viertel hautnah miterlebt: Sie ist Quartiersmanagerin im Soldiner Kiez. Eingesetzt vom Land Berlin, sollen diese Manager helfen, Anwohner, Initiativen und Institutionen zusammenzubringen und mit Projekten und neuen Ideen den Niedergang zu stoppen. Viel habe sich in der Vergangenheit zum Besseren verändert, erzählt Svenja Wagner in ihrem Büro in der Koloniestraße, viele Projekte seien in Angriff genommen worden. Problematisch sei weiterhin die Armut der Bewohner und ihre Folgen – Nachhilfeunterricht kann sich hier kaum jemand leisten. „Fast alle Bildungseinrichtungen werden überflutet mit Anfragen.“
Wagner ist nicht allein mit ihren Bemühungen. Es gibt einen Kiezverein, es gibt das Familienzentrum „Pankhaus“ und die „Fabrik Osloer Straße“, wo ebenfalls soziale Einrichtungen und Initiativen zu finden sind. Und es gibt Menschen wie Yousef Ayoub. Der 32-jährige Palästinenser ist im Viertel aufgewachsen und zur Schule gegangen. Heute wohnt er ein paar Querstraßen weiter, arbeitet aber im Kiez als Erzieher an einer Grundschule. Vorfälle wie der am Montag, erzählt er, gehörten früher zum Alltag. „Wenn es Konflikte gab, sind die schnell ausgeartet. Die Polizei ist damals immer gleich mit mehreren Mannschaftswagen angerückt.“ 2009 habe er deshalb bei der Polizei angeregt, ob sie nicht durch gemeinsame Projekte mit Anwohnern gegenseitige Vorurteile abschaffen wolle. Sie wollte.
So entstand der „Kiezbezogene Netzwerkaufbau“, 28 Einrichtungen beteiligen sich heute. Sie machen gemeinsam Sport, kochen, es gibt Kiezspaziergänge – und immer in Kooperation mit der Polizei. Die Vorfälle von Montag, sagt Ayoub, seien inzwischen die Ausnahme. „Ich habe die Familie kontaktiert, am Donnerstag treffen sie sich mit der Polizei.“ Es sei keine arabische Großfamilie, stellt er klar, und sicher sei an diesem Abend die Kommunikation fehlgeschlagen. „Jeder empfindet sich ungerecht behandelt, jeder verlangt Respekt, so wird aus einem kleinen Einsatz ein großer.“
Freude in Friedrichshain
Es wurde ein Einsatz, der etwa neun Kilometer vom Soldiner Kiez entfernt Aufmerksamkeit erregt hat und politisch ausgeschlachtet wurde: in der Rigaer Straße in Friedrichshain. Am Mittwoch hingen im Wedding Plakate mit dem Slogan, den die Anwohner den Polizisten entgegengerufen hatten – nun aber in der Mehrzahl. „Haut ab, das sind unsere Straßen.“ Unterzeichnet mit „Grüße aus der Rigaer Straße“.