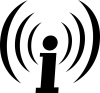Die „Köpi“ ist eines der ersten besetzten Gebäude der Nachwendezeit. Zum 25. Jubiläum wird heftig diskutiert
Gespenstisch ragt die „Köpi“ zwischen den glatten Hochhäusern der schier endlos langen Köpenicker Straße in Berlin-Mitte empor: Man erkennt die Nummer 137 sofort. Das 1.900 Quadratmeter große Grundstück mit Haus und Wagenplatz feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag – genauer: Es feiert das Jubiläum seiner Besetzung. Die dezente Ironie der Geschichte: Als es vor einem Vierteljahrhundert von West- und Ostberlinern gemeinsam übernommen wurde, tauchte hierzulande gerade erstmals der Begriff Gentrification auf, im Zusammenhang mit den Sanierungsgebieten Mitte, Prenzlauer Berg und Friedrichshain. Wissenschaftler, Journalisten und Bürger tasteten sich zunächst noch zaghaft an das neue, aus den USA stammende Wort heran.
Mittlerweile hat sich die Aufwertung von Stadtteilen und die damit einhergehende Verdrängung von Bewohnern so weit ausgedehnt, dass „Gentrifizierung“ in Berlin als Universalschimpfwort gebraucht wird. Damals gab es noch leer stehende Häuser, die besetzt werden konnten – und wurden. Heute mangelt es an Wohnraum im Stadtkern, werden die Mieten, nicht nur in Berlin, zunehmend unbezahlbar. Wäre ein Projekt wie die „Köpi“ heute überhaupt noch möglich? Oder gäbe es andere Möglichkeiten, Wohnraum in Besitz zu nehmen? Bei einer Aktionswoche, mit Filmen, Konzerten und Gesprächspodien, wollen die „Köpi“-Leute das mit Gleichgesinnten und Neugierigen diskutieren.
Am Eingangstor ertönt Punkmusik, im Hof stehen Menschen mit einschlägigen Haarschnitten zwischen Sperrmüllinstallationen rund um ein Feuer. Sie scheinen jeden Fremdkörper gleich zu erkennen, auch mich. „Zieh dich nicht zu schick an“, riet mir eine etwas ältere Kollegin, „auch Hausbesetzer haben ihren Dresscode“, und ich befolgte ihren Rat. Meine leichte Orientierungslosigkeit scheint jedenfalls schon auszureichen, um sofort enttarnt zu sein. Und dann auch mein Husten. Warum, frage ich mich beim Betreten des AGH, einer Kneipe auf dem Gelände, die offiziell gar keine sein darf und die innerhalb weniger Minuten so verraucht sein wird, dass mein einziger Beitrag zur Diskussion ein Räuspern und Bellen sein kann – warum gehört zum Hausbesetzen ein ungesunder Lebensstil? Oder ist das Rauchen hier etwa eine politische Angelegenheit?
Die 25 Jahre haben dem Haus zu schaffen gemacht, sehe ich. Grüner Putz rieselt von der Stuckdecke. Die Wände sind bemalt, die Böden dreckig, aus einem Rohr an der Decke pumpt etwas, das Heizungsluft sein könnte, in den Raum. Oute ich mich mit diesen Gedanken schon als Vertreterin einer verhassten bürgerlichen Ästhetik?
Das Publikum versammelt sich mit veganem Essen aus der „Vokü“ zu einer Podiumsdiskussion mit dem Titel „Besetzen, mieten, kaufen“. Vorn sitzen Bewohner der besetzten Häuser „Köpi“ und „Kastanie“ (Kastanienallee 85), aus der Rigaer Straße 94, „94“ genannt, aus dem „Schokoladen“ in der Ackerstraße und der „SOG“, der Selbstverwalteten Ostberliner Genossenschaft. Auch ein Vertreter des Mietshäusersyndikats ist anwesend. Ihnen allen geht es um den Erhalt von bezahlbarem Wohnraum – nur auf unterschiedliche Weise. Schnell wird klar, dass es in dieser Frage zwei Strategien, zwei Seiten gibt: diejenigen, die ihr besetztes Haus bürgerlich-vertraglich in Eigentum umgewandelt haben – und diejenigen, die autonom bleiben.
Dass beide Fraktionen auf unterschiedliche Weise nicht so radikal sind, wie sie vorgeben, wird ebenso rasch deutlich. Wenn es darum geht, ein Haus nur zu besetzen, weil man kein Geld hat, so wie Daniel aus der „Kastanie“ es erzählt, wo ist Wohnen dann noch politisch? Vor allem, wenn man sich mit Geldern von der Deutschen Kreditbank DKB (im Fall der „Kastanie“) oder von der Edith-Maryon-Stiftung („Schokoladen“) unterstützen lässt – also „kaufen lässt“, wie ein junger Mann aus der „94“ bemängelt.
Viele sind von Räumungsklagen genervt. Man wolle zwar „kein linkes Altersheim“ sein, sagt der 40-jährige Daniel aus der „Kastanie“, aber so oft, wie er schon geräumt worden sei, schwinde die „Power“ schnell. Mit einem legalen Status könne man viel mehr beeinflussen. Auch Jana vom „Schokoladen“ ist dieser Ansicht. Der Kapitalismus sei nun mal Fakt. Im städtischen Raum werde automatisch Mehrwert geschaffen – die Frage sei nur, wie man ihn verteile, daran müsse man eben mitwirken.
Aus diesen Stimmen spricht die Erfahrung der Älteren, die dem jungen Mann aus der „94“, der sich unter keinen Umständen „kaufen lassen“ will, vielleicht noch fehlt. In seinem Hausprojekt, das als Bastion der linksradikalen Szene gilt, ist man der Ansicht, dass man – sobald die Gentrifizierung im eigenen Umfeld zu weit um sich greife – ohnehin gehen müsse. Daniel aus der „Kastanie“ kritisiert hingegen: „Zu sagen: Der Kiez ist jetzt scheiße, da zieh ich weg, ist doch kacke!“ In diesem Fall wäre man ja auch wieder bloß Teil der Gentrifizierung.
Worum geht es den Besetzern eigentlich, frage ich mich, je später der Abend wird, umso dringender. Will man bezahlbaren Wohnraum auch für nachfolgende Generationen? Dann scheint der Weg der Legalisierung doch unvermeidbar. Oder bleibt man seiner radikalen Haltung treu, die Eigentum grundsätzlich verbietet? Die Diskussion verliert sich in Redundanzen. Und immer wieder in gegenseitigen Verdächtigungen, ob der eine oder andere nicht doch einfach nur Wohnraum für sich selbst sichern will und dies unter dem Deckmantel einer politischen Haltung versteckt.
Noch vor Ende des Streits gehe ich. Und finde es schade, dass wohl vor allem szeneinterne Gäste gekommen sind. Der Miet- und Immobilienmarkt, die Wohnfrage: Das beschäftigt doch viele Leute! Bislang haben die meisten Hausprojekte nur Lösungen auf Zeit gefunden. So haben die Leute von der „Köpi“ sich gegen den Kauf des Grundstücks entschieden, 2007 aber Pachtverträge für 30 Jahre abgeschlossen. Was danach passiert, wird uns das Seniorenkollektiv schon husten.