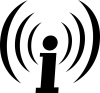Zwischen regionalem »Nationalismus« und den Erfahrungen von 1989
Auch wenn die 13. Pegida-Demonstration am Montag in Dresden wegen Terrordrohungen abgesagt wurde, ist der Zuspruch ungebrochen. Anderswo bleibt er aus. Die Frage lautet: Warum Dresden?
In johlenden Beifall verfällt die Menge auf den Dresdner Demonstrationen der »Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes« zuverlässig, wenn Lutz Bachmann seinen Lieblingssatz in das Mikrofon ruft: »Dresden zeigt, wie's geht.« Spätestens seit der zwölften Auflage ist eine Ergänzung angebracht. Vorigen Montag gingen erstmals nicht nur Nachahmer von Pegida in Köln oder München auf die Straße – versprengte Häufchen, die sich viel Protest gegenüber sahen. Vor allem gab es den mit Spannung erwarteten ersten Marsch von »Legida« in Leipzig. Er geriet zur Pleite. 4500 Teilnehmer wurden von 30 000 Gegendemonstranten an die Wand gespielt. Pegida wächst nicht zur überregionalen Bewegung; der ganz große Zuspruch ist auf Sachsens Landeshauptstadt beschränkt. Eigentlich müsste Bachmann also sagen: »Nur Dresden zeigt, wie's geht.«
Warum fasst eine Initiative, die sich vordergründig um »Überfremdung« sorgt – sprich: Zuwanderung der vermeintlich »falschen« Menschen in angeblich zu großer Zahl – ausgerechnet in einer Stadt Fuß, die eine der wenigen boomenden Metropolen im Osten ist? Die keine Schulden hat, rasant an Einwohnern gewinnt, über eine Exzellenzuniversität verfügt und Touristen in hellen Scharen anzieht? In der die Chipindustrie ebenso lukrative Jobs bietet wie die Ministerien? In deren Villenvierteln entlang lieblicher Elbhänge ein sich als kultiviert empfindendes Bürgertum gediegen lebt – und die, sagt der Schauspieler Friedrich-Wilhelm Junge, auch deshalb so ansehnlich ist, weil fachkundige Zuwanderer die barocke Pracht mit zu errichten halfen?
Über mögliche Antworten wird viel sinniert. In den Analysen geht es um die Mentalität der Ostdeutschen, der Sachsen und der Dresdner; um die politische Kultur im Freistaat im Laufe der Jahrzehnte; um die Kluft zwischen dem schönen Schein amtlicher Selbstdarstellung und der täglichen Lebensrealität. Indes: Belastbare Erkenntnisse gibt es kaum. Zwar veröffentlichte die TU Dresden Ergebnisse einer Umfrage unter Pegida-Anhängern, die Staunen erregte. Der durchschnittliche Pegidist entstammt demnach der Mittelschicht, ist 48 und männlich, gut ausgebildet, hat Arbeit und verdient für sächsische Verhältnisse passabel. In der Menge, die sich montags im Lingnerpark oder auf dem Theaterplatz versammelt, scheinen also weder frustrierte Rentner zu dominieren noch Rechte und Hooligans. Die verblüffendste Erkenntnis: Der Islam sorgt nur eine Minderheit der Teilnehmer. So fremdenfeindlich wie gedacht, konnte man glauben, ist Pegida ja gar nicht.
An der TU-Umfrage gibt es inzwischen geharnischte Kritik. Sie stützt sich vor allem auf die Tatsache, dass zwei Drittel der Angesprochenen die Teilnahme verweigerten – mutmaßlich jene, die die extremeren Ansichten vertreten. Das einzig mögliche Fazit aus der Studie über die Pegida-Demonstranten müsste daher nach Ansicht des Bloggers Stefan Niggemeier lauten: »Pegida-Demonstranten lehnen Teilnahme an Studien ab«.
Mangels fundierterer Erkenntnisse und angesichts wenig ausgeprägter Dialogbereitschaft der Pegidaanhänger ist man vorerst auf Mutmaßungen angewiesen. Der Dresdner SPD-Mann Peter Lames sieht Pegida als »Versammlung von Menschen, die sich in den alltäglichen Erfolgsbotschaften nicht wiederfinden« – eine Veranstaltung von Enttäuschten und zu kurz Gekommenen also. In einem Interview konstatiert er ein »Auseinanderklaffen der rosigen Darstellungen« sowie wirtschaftlicher Probleme vieler Menschen. »Wir reden zehnmal mehr über den Striezelmarkt als über den Arbeitsmarkt. Umgekehrt wäre es richtig.«
Sind also doch vor allem die da oben Schuld, die Politik, die Medien, die bei Pegida nur »Lügenpresse« heißen? Für Johannes Lichdi, Stadtrat der Grünen, greift das zu kurz. Im Berliner »Tagesspiegel« beschreibt er die Kundgebungen und die dort geäußerten Ressentiments vielmehr als Beleg dafür, dass Dresden, das gern europäische Kulturmetropole wäre, tatsächlich ein »borniertes und engherziges Provinznest« ist. Ein Nest, in dem man lieber eine Brücke baut als Welterbe zu sein; in dem moderne Architektur kaum eine Chance hat und alternative Kultur mit scheelen Blicken bedacht wird. Eine Stadt vor allem, in der nach Lichdis Ansicht viele Bürger die Entwicklung nach 1989 »nie verstanden oder akzeptiert« haben. Sie fühlten sich »belogen und betrogen«, weil ihnen der Westen zwar Reisefreiheit gebracht hat, aber ihnen auch die »Verwirrungen offener Gesellschaften« einbrockte, in denen Autoritäten zerbröckelten und »jeder seinen eigenen Weg suchen muss«.
Diese Einschätzung liegt nicht weit entfernt von der, die Grit Hanneforth trifft. Sie leitet das »Kulturbüro Sachsen«, das sich seit Jahren um Demokratiebildung im Freistaat kümmert. Sie sieht viele Sachsen noch immer in einer Denkweise verhaftet, die sich im DDR-Eingabewesen ausdrückte: Wenn etwas nicht funktionierte, wurde ein Brief nach oben geschrieben – zur Not an den SED-Generalsekretär: »Das half immer.« Derzeit gebe es erneut verbreitete Unzufriedenheit mit den Verhältnissen – die zu ändern aber nur von anderen gefordert werde: »Man will sich selbst nicht einbringen in die Gesellschaft. Man formuliert nur Forderungen und fragt nicht: Was ist mein Beitrag?«
In Sachsen war diese Mentalität in den vergangenen 25 Jahren auch politische Staatsräson. Engagement im »Ehrenamt« wurde gefördert, politische Beteiligung nicht. Volksbegehren hatten kaum je Erfolg; die Hürden sind sehr hoch. Das hat Tradition: Sachsen waren in der Geschichte meist staatshörig und königstreu. Die CDU-geführten Regierungen der vergangenen 25 Jahre knüpften daran bewusst an. Sie päppelten den Stolz der Sachsen auf ihre Herkunft und ihre Fähigkeiten – und impften ihnen zugleich das Vertrauen ein, die da oben würden es schon richten. Auffällig: Selbst eine Anti-Pegida-Kundgebung, zu der am vorigen Samstag 35 000 Menschen strömten, kam erst auf Initiative der »Obrigkeit«, also von Regierungs- und Rathausspitze, zustande. Am Montagabend ist von diesen jedoch nichts zu sehen. »Ein Symptom des Zustandes der Landespolitik«, sagt Rico Gebhardt, Fraktionschef der LINKEN. Die sächsische Devise laute: »Abwarten, aussitzen, abmoderieren und im Notfall scheinheilige Symbolik«.
Auch der Sachse allerdings kann, wenn er die Nase voll hat, aufmüpfig
werden. Vorgetragen werden Forderungen heute nicht mehr in Eingaben und
Briefen an führende Politiker, sondern auf der Straße. Darin
manifestiere sich eine spezifische, »tiefgreifende kollektive Erfahrung«
in Ostdeutschland, glaubt David Begrich vom Verein »Miteinander« in
Magdeburg: der »Mythos '89«. Er beschreibt die Vorstellung, wonach die
Bürger »ein imperatives Mandat haben, Volkes Wille auf die Straße zu
tragen, wenn die Führung nicht so will wie sie«. Das freilich sei ein
Handlungsmuster, mit dem der Politikbetrieb West nichts anfangen kann –
so, wie umgekehrt viele Ostdeutsche eine »absolute Distanz« zu
politischen Institutionen in der Bundesrepublik pflegten: »Das sind zwei
Systeme, die nicht miteinander können«, sagt Begrich.
In Dresden wird der »Mythos '89« derzeit wieder gepflegt: mit schwarz-rot-goldene Fahnen, mit Handys, die statt Kerzen in die Nacht blinken, und mit dem Ruf »Wir sind das Volk«. Der freilich ist auf zweierlei Weise zu verstehen: Bekundet wird der Anspruch, »die da oben« unter Druck zu setzen – und zu bestimmen, wer dazu gehören darf: »Wir sind das Volk!« Wir – die arbeitende Mittelschicht; wir – die Sachsen. Damit ist auch gesagt, wer nicht dazu gehört: Zuwanderer, die anders sind und anders bleiben. Man habe nichts gegen Muslime, sagt Bachmann, der diese sogar einlädt zu den Kundgebungen – freilich nur die »integrationswilligen« unter ihnen; jene, die im Alltag nicht auffallen.
Es ist dies, sagt Begrich, ein Begleiteffekt des Sachsenstolzes, der in handwerklicher Geschicklichkeit und Erfindergabe wurzelt – und zu dessen eher unangenehmen Begleiterscheinungen ein Phänomen gehört, das man »regionaler Nationalismus« nennen könnte: die dezidierte Überzeugung, wie man zu leben und sich zu verhalten hat und wie nicht. »Nirgendwo in Deutschland ist die Ablehnung des Anderen tiefer in Politik und Kultur verankert als in diesem Bundesland«, schreibt der Politologe Michael Lührmann in einem Essay in der »Zeit«. Lührmann ist in Leipzig gebürtig – einer Stadt, die vielleicht die Ausnahme zur Regel darstellt: seit Jahrhunderten Messestadt und offen für die Welt. Eine Stadt, die »Kreativität und Modernität als Chance begreift«, sagt Hannefort – anders als die Residenzstadt Dresden oder ihre Umgebung. Dort findet man, was Lührmann das »ultrakonservative Milieu des sächsischen Bibelgürtels« nennt: Ein Milieu, das Abtreibung und Homoehe ebenso ablehnt wie Linke und Muslime. Es ist die Region zwischen Lausitz und Erzgebirge, aus der viele Autos kommen, die regelmäßig montags in Dresdens Straßen geparkt sind, nahe der Bühne, auf der Bachmann sagt: »Dresden zeigt, wie's geht.«