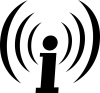Offensichtlich gibt es ein großes Bedürfnis über die Versorgung von Flüchtlingen in Berlin grundsätzlicher zu reden. Zur Veranstaltung des AStA der Alice Salomon Hochschule (ASH) in Berlin Hellersdorf mit dem Titel „Heime, Lager, Unterbringung – Die Berliner Unterbringungspolitik“ kamen gestern gut 100 ZuhörerInnen. Ergebnis: Wer Lagerunterbringung verhindern will, sollte privaten Wohnraum akquierieren. Wer Flüchtlinge in Sammelunterkünften unterstützen will, sollte es an den richtigen Stellen tun: Versorgung mit dem Nötigsten, Wohnraum, Rechtsberatung, Sprachkurse und das Eröffnen langfristiger Perspektiven, die aus der gesellschaftlichen Isolation herausführen.
Zuerst faßte Christian Schröder, Mitarbeiter der Piraten im Abgeordnetenhaus, die „Notstands-Politik“ des Berliner Senats in den letzten Jahren zusammen. Die Flüchtlingszahlen steigen nämlich eigentlich schon seit 2010. Damals lebten rund 10.000 Flüchtlinge in Berlin die Anrecht auf Unterbringung und Versorgung hatten. Davon waren 15% in Sammelunterkünften untergebracht – alle anderen haben Privatwohnungen gemietet. Heute sind es 18.000 Flüchtlinge wovon mitlerweile 70% in Lagern leben müssen. Der Hauptgrund ist der verknappte Wohnungsmarkt und fehlende Unterstützung bei der Wohnungssuche.
Der Anstieg der Flüchtlingszahlen ist also nicht allein für die aktuelle Unterbringungsmisere verantwortlich, sondern vor allem Versäumnisse des Senats. Der hatte viel Zeit Vorsorge zu treffen, hätte die Kapazitäten in einem geschützten Wohnungsmarktsegment mit Hilfe des landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften hochfahren (derzeit gerademal 275 Wohnungen) oder auch kleinere Gemeinschaftsunterkünfte schaffen können. Statt dessen wurden „on demand“ große Massen-Notunterkünfte eingerichtet, die nichtmal den selbstgewählten Berliner Standards entsprechen müssen. Die Ergebnisse dieser Politik sind die Traglufthallen in Mitte, die Belegung von Turnhallen (seit gestern sind es sieben), die Containerlager und das massenhafte Unterlaufen sozialpolitischer Standards. Die gibt es sonst überall da wo viele Menschen zusammen untergebracht werden, nur nicht bei Flüchtlingen.
Auch die Personalausstattung des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LaGeSo) wurde nicht den steigenden Flüchtlingszahlen angepasst, obwohl es seit 2012 regelmäßige Beschwerden über die Arbeitbelastung gibt. Die temporäre Schließung des LaGeSo, die langen Schlangen vor dem Amt, das Chaos bei der Vergabe von Krankenscheinen, Taschengeld, Übernachtungsgutscheinen usw. ist also auch ein selbstherbeigeführter Notstand. Zudem hat das LaGeSo die Kontrolle der Sammelunterkünfte (vor allem der privaten Betreiber) vernachlässigt, was dem Geschäftsmodell „Lagerunterbringung“ zu guten Renditen verhalf. Wenig Personal, misserable Ausstattung und der Missbrauch von Sachspenden aus der Bevölkerung halfen Betreibern wie Gierso, Prisod oder PeWoBe marktfähiger zu sein als gemeinnützige Sozialträger.
Einen wesentlichen Schub bekam die Debatte im Abgeordnetenhaus eigentlich erst durch die Ereignisse um die Gerhart-Hauptmann Schule in Kreuzberg und nach den Fällen von Misshandlungen an Flüchtlingen in NRW. Vorher spielten all die Verfehlungen des Sozialsenats eine untergeordnete Rolle in Ausschüssen und kleineren Debatten. Letzte Woche hat der Senat nun Eckpunkte für ein umfassendes Konzept vorgelegt, dass die bisherige Politik bestätigt und, wenn es denn mal progressiver wird, keine konkreten Zielvorgaben macht. Sinnvolle Sofortmaßnahmen wären z.B. nur noch Wohlfahrtsverbände als Betreiber zu beauftragen, kleinere dezentrale Unterkünfte für maximal 50 Personen einzurichten, das Wohnungskontigent im geschützten Marktsegment aufzustocken, die Vergabe von Baugenehmigungen an einen bestimmten Prozentsatz Sozialwohnungen zu koppeln, mehr für Beratungen und Personal auszugeben usw.-. Doch dazu müsste der politische Wille erstmal da sein.
Als zweiter Referent rückte Bruno Watara von afrique-europe-interact das Bild von Flüchtlingen im Lageralltag zurecht. Dieses ist weit entfernt von der Vorstellung einer selbstgewählten Wohngemeinschaft. Sprachliche und kulturelle Barrieren erschweren das Zusammenleben, es kommt zu Auseiandersetzungen und sozialem Stress. Er hat neun Jahre in einer Massenunterkunft verbracht und konnte dort nur mühsam eine Widerstandskultur gegen die Schikanen der Behörden und der Heimleitung durchsetzen. Zustände, auch wenn sie lebensbedrohlich sind, werden hingenommen, um den eigenen Aufenthalt oder das persönliche Verhältnis zum Personal nicht zu gefährden. Ob nun Container, Notunterkunft oder alte Kasernen: Flüchtlinge sind exkludiert vom Rest der Bevölkerung.
Außerhalb des Lagers ist das Gefühl des Nichtdazugehören immer präsent, sei es durch Essens-Gutscheine (wie in Hennigsdorf), durch Kontrollen oder rassistische Anfeindungen aufgrund des Aussehens. Aus dieser mehrfach stigmatisierenden Position heraus lasssen sich keine Verbesserungen durchsetzen. Deshalb hat er sich an Demonstrationen und der NoLagerTour 2005 beteiligt, die auch mit Unterstützung von außen organisiert wurden. Das Wichtigste sei Flüchtlinge aus ihrer Isolation herauszuholen. Denn jene, denen das nicht gelingt, sind verdammt ihr Leben im Lager abzusitzen, manchmal für Jahrzehnte, um letztlich dort zu sterben. Zurückkehren in das Heimatland steht außer Frage. Meist ist der Kontakt zur Familie abgerissen, die Rückkehr mit vielen Unsicherheiten behaftet oder die Chance noch irgendwas mit dem Leben anzufangen gering. Für ihn ist klar: Flüchtlingen wird in Deutschland durch die aktuelle Gesetzeslage (Arbeitsverbot etc.) viel Lebenszeit gestohlen. Eine Linderung der Mehrfachisolation wäre die Abschaffung der Lager und zumindest das Leben in normalen Wohnungen.
Die Gruppe Grenzen_weg, die sich an der ASH gegründet hat, unterstützt Flüchtlinge in Hellersdorf seit 2013. Sie bieten unter anderem Beratungen in Sachen Wohnungssuche an. Die beiden VertreterInnen berichteten auf der Veranstaltung von den Schwierigkeiten, die sie dabei hatten. Zum einen, sich überhaupt Zugang in das Lager Carola-Neher-Str. zu verschaffen um dort mit Flüchtlingen ins Gespräch zu kommen. Zum anderen, dann konkret in der Ausführung von Projekten und Sprechstunden in Absprache/Übereinstimmung mit dem Lagerbetreiber, den SozialarbeiterInnen und der Heimleitung. So steht zwar neuerdings in den Betreiberverträgen dass politischen Initiativen Räume zur Verfügung gestellt werden müssen, doch hat der Betreiber immer noch Hausrecht und kann unliebsame Aktivitäten vor die Tür setzen. Die Schlichtungsstelle beim LaGeSo hat bisher einen Fall behandelt – zugunsten des Betreibers.
Als auch die Initiative Hellersdorf hilft Probleme mit dem Betreiber hatte, haben sie gemeinsam eine Begegnungsstätte außerhalb der Unterkunft, das LaLoKa, eröffnet. Hier soll Flüchtlingen Raum gegeben werden sich ohne Aufsicht des Betreibers zu betätigen, Beratungen zu besuchen oder einfach nur im Internet zu surfen. Der Raum ist leider auch Bedrohungen durch Neonazis ausgesetzt.
Die Auseinandersetzungen mit Neonanzis und RassistInnen im Bezirk hat in den letzten Monaten stark zugenommen. AntirassistInnen finden sich dann oft in der Position wieder Containerlager vor den Anfeindungen zu verteidigen. Deshalb positioniert sich die Gruppe auch gegen Lagerunterbringung an sich und prüft im Rahmen eines „critical monitoring“ die Standards der Einrichtungen um Druck auf die Betreiber auszuübern. Insgesamt hat das ehrenamtliche Engagement aber immer Ressourcenprobleme. Die Begleitung von Flüchtlingen zu potentiellen Vermietern oder zu Behörden konnte nur selten gestellt werden.
Einen wichtigen Beitrag um Flüchtlinge mit Wohnraum zu versorgen ist die vom LaGeSo seit Februar 2014 finanzierte Beratungsstelle des Evangelischen Fürsorgewerks „Wohnungen für Flüchtlinge“. Die Beratung sammelt nicht nur frei werdene Wohnungen, sondern koordiniert auch die Warteliste, hilft bei den Gesprächen mit den Vermietern und kümmert sich um den Formalkram. Die ehrenamtliche Initiative Solizimmer vermittelt hingegen obdachlose Flüchtlinge, die noch nicht oder nicht mehr vom LaGeSo erfasst werden (z.B. Flüchtlinge aus der Gerhart-Hauptmann-Schule). Wer also Leerstand bemerkt, Zimmer übrig hat oder NachmieterInnen sucht, soll sich bei diesen beiden Stellen melden.
Yves Müller, Mitarbeiter im Zentrum für Demokratie Treptow/Köpenick, ging als Hauptamtlicher in seinem Beitrag auf die Strukturen der organisierten Zivilgesellschaft im Rahmen der Flüchtlingsunterstützung ein. Die Beratungskompetenzen und Angebote in den BürgerInnenzentren und Strukturen der politischen Bildung auf Bezirksebene mussten sich auch erst an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen. Während sie vorher vor allem Rechtsextremismus-Prävention und antirassistische Bildungsarbeit betrieben, sollen sie nun Willkommens-Initiativen koordinieren und Konzepte gegen rassistische Anwohnerinitiativen entwickeln. Dazu gehöre beispielsweise die viel beschworene „Willkommenskultur“ zu definieren und an ihrer Verwirklichung zu arbeiten. Es geht dabei ja nicht nur um die Abwesenheit rassistischer Bedrohungen im Nahumfeld von Flüchtlingsunterkünften, sondern auch um die Alltäglichkeit von Freizeitangeboten, Begegnungen und das Verhalten bezirklicher (Ämter-)Strukturen, der Schulen, Kitas usw. gegenüber den neuen BewohnerInnen. Da ist noch viel Nachholbedarf.
Gerade in Köpenick war es schwierig, neben den rassistischen Mobilisierungen und der öffentlichen Aufmerksamkeit, gewisse Standards der Solidaritätsarbeit (z.B. immer mit den Betroffenen, statt mit den Betreibern) in den frisch gegründeten Willkommens-Initiativen und Runden Tischen durchzusetzen. Die meisten Angebote, die zunächst auf die Betreiber und Flüchtlinge niederprasseln, sind wenig nachhaltig und schlicht unangemessen. Frustration und Enttäuschung über fehlende Dankbarkeit und Nichtnutzung gutgemeinter Angebote, machen sich schnell in Willkommens-Initiativen breit, wenn nicht vorher darüber gesprochen wird welche Angebote überhaupt Sinn machen. Empathie und Verständnis für die unterschiedlichen Lebens- und Problemlagen lässt sich nur im dirketen Gespräch mit den Flüchtlingen entwickeln.
Aufgabe der hauptamtlichen Strukturen auf Bezirksebene muss es zudem auch sein althergebrachte Konzepte der Integration zu hinterfragen. So haben sich die „Willkommensklassen“ (Beschulung nichtdeutschsprachiger Kinder und Jugendlicher) an den Berliner Schulen zwar durchgesetzt, aber ohne ein richtiges pädagogisches Konzept aufzuweisen. Hier auf Standards zu drängen und diese zu prüfen muss auf Bezirksebene, in den Ausschüssen der Bezirksverordnetenversammlungen und in jeder einzelnen Schule passieren. Die Kritik am Senat und am LaGeSo darf nicht die bezirklichen Verantwortungsbereiche verschleiern.