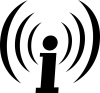Positionspapier der Antifaschistischen Koordination Köln und Umland (AKKU) Am 20. Januar 2015 werden die ersten Betroffenen des Kölner Nagelbombenanschlags im NSU-Prozess am Münchener Oberlandesgericht befragt. Manche treten als Zeug*innen, andere als Nebenkläger*innen – oder beides – im Prozess gegen Beate Zschäpe und vier weitere Angeklagte aus dem Untersützer*innen-Netzwerk des „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU) auf. Die juristische Aufarbeitung der Taten des NSU soll im Prozess in München passieren. Ob das gelingen kann, bezweifeln wir – und dennoch: Dies ist bisher der einzige öffentliche, vom Staat gegebene Raum, in dem die Betroffenen des NSU eigene Forderungen stellen und ihre Perspektive darlegen können.
Am 20. Januar 2015 werden die ersten Betroffenen des Kölner
Nagelbombenanschlags im NSU-Prozess am Münchener Oberlandesgericht
befragt. Manche treten als Zeug*innen, andere als Nebenkläger*innen –
oder beides – im Prozess gegen Beate Zschäpe und vier weitere Angeklagte
aus dem Untersützer*innen-Netzwerk des „Nationalsozialistischen
Untergrund“ (NSU) auf.
Nachdem am 9. Juni 2004 in der Kölner Keupstraße eine vom NSU deponierte
Nagelbombe explodierte und 22 Menschen teils schwer verletzte,
konzentrierten sich die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden
ausschließlich auf die Opfer und deren Angehörige. Jahrelang waren sie
Verdächtigungen und rassistischen Zuschreibungen ausgesetzt,
gleichzeitig blieb eine solidarische Unterstützung seitens der Kölner
Öffentlichkeit aus. Die Betroffenen machten eine doppelte
Gewalterfahrung; indem sie erst von dem Anschlag selbst, dann von der
Nicht-Unterstützung und dem institutionellen und gesellschaftlichen
Rassismus getroffen wurden.
Wir werden zusammen mit der Initiative „Keupstraße ist überall“ die
Betroffenen solidarisch nach München begleiten. Gemeinsam stellen wir
die Forderungen nach schonungsloser Aufklärung und werden unseren
Protest gegen die jahrelange Diskriminierung auf die Straße tragen.
Warum wir es aus antifaschistischer Perspektive wichtig finden,
gemeinsam nach München zu fahren, haben wir in diesem Aufruf formuliert.
Wie reagierte die (Kölner) Antifa?
Anfang der 1990er Jahre verübten Neonazis und rassistische Bürger*innen
zahlreiche Pogrome und Brandanschläge, beispielsweise in Hoyerswerda und
Rostock-Lichtenhagen. Diese und die nachfolgende Welle rechter Gewalt
richtete sich in Ost- und Westdeutschland gegen Menschen mit
Einwanderungsgeschichte und Geflüchtete. In NRW findet sich ein Beispiel
für einen solchen Brandanschlag in Solingen, wo 1993 gezielt das
Wohnhaus einer in Deutschland lebenden Familie als Anschlagsziel
herausgesucht wurde. Fünf Menschen starben bei dem Brandanschlag. Kurze
Zeit später, 1996, brannte in Lübeck eine Flüchtlingsunterkunft. Zehn
Menschen wurden dabei ermordet. An diesen Fällen wird deutlich, dass
weder das Ziel des NSU, etablierte Migrant*innen zu treffen, neu war,
noch das Vorgehen der Ermittlungsbehörden, die Opfer zu Tätern zu
machen. Wenige Tage nach dem Anschlag in Lübeck präsentierten Polizei
und Staatsanwaltschaft einen angeblichen Täter: Safwan Eid, einer der
Bewohner, der zusammen mit seiner Familie Opfer des Brandes war. In
diesem Fall wurde von linker Seite interveniert und darauf
hingearbeitet, dass die wahren Täter*innen gefunden wurden. Safwan Eid
wurde, wenn auch erst nach vielen Jahren, letztendlich freigesprochen.
Was war hier anders als in Köln? Warum waren Antifaschist*innen in
Bezug auf den Anschlag in der Keupstraße auf dem rechten Auge blind?
Wenige Wochen vor dem Anschlag in der Keupstraße löste sich die damals
einzige handlungsfähige Antifa-Gruppe in Köln, die „Antifa K“, auf.
Dadurch fehlte eine antifaschistische Struktur, in der der
Nagelbomben-Anschlag hätte diskutiert werden können. Das allein reicht
als Erklärung lange nicht aus, schließlich gab es die Antifaschist*innen
noch, ebenso Antira-Kreise in der Stadt.
Anders als in Solingen und Lübeck z.B. waren die Täter*innen nicht in
die regionale Neonazi-Szene eingebunden. Es gab im Vorfeld keine Häufung
rechter Gewalttaten, die auf diese Eskalation hingedeutet hätte.
Außerdem galt ein Nagelbombenanschlag nicht als „typisches“ Tatmittel
wie Totschlag oder ein Brandanschlag, sondern setzte Spezialwissen
voraus, dass der lokalen Neonazi-Szene schlichtweg nicht zugetraut
wurde. Diese Analyse beruhte auf eigenen Einschätzungen und
Erkenntnissen, die das Ausmaß der Verstrickungen allerdings nicht
erfassen konnten.
Zwar gab es eine Aktion zum Anschlag auf der Keupstraße und ein
Flugblatt, aber darüber hinaus nicht viel Widerstand – auch nicht gegen
die Kriminalisierung der Anwohner*innen. Es bestanden damals kaum
Kontakte zu den Bewohner*innen der Keupstraße. Auch nach dem Anschlag
wurde nicht versucht, diese Kontakte zu den Betroffenen herzustellen.
Hier müssen wir selbstkritisch sein: wir als Antifaschist*innen waren
nicht frei von Vorurteilen, und auch wir nahmen die Keupstraße teilweise
als „Parallelwelt“ wahr.
Was ist seitdem passiert?
Die Aufarbeitung der NSU-Anschläge begann erst nach seiner
Selbstenttarnung im November 2011 und ist noch lange nicht
abgeschlossen. Und: die bisherige Bilanz fällt ernüchternd aus.
Das Entsetzen der breiten Öffentlichkeit war zwar groß, als die Taten
des NSU ans Licht kamen, eine grundsätzliche gesellschaftliche Debatte
über Rassismus in Deutschland hat sie dennoch nicht nach sich gezogen.
Vereinzelt gab und gibt es zwar Zeichen gesellschaftlicher Solidarität,
wie beispielsweise das Straßenfest „Birlikte“ in der Keupstraße im Juni
2014. Diese Solidaritätsbekundungen gehen aber häufig nicht über den
einen Moment hinaus und formulieren keinen Zusammenhang zwischen der
Kontinuität des Rassismus in der Gesellschaft und den einzelnen Taten
des NSU. So fehlt die Auseinandersetzung mit dem institutionellen und
gesellschaftlichen Rassismus, der diese Taten erst möglich gemacht hat.
Außerdem wird oft vergessen, dass der NSU auf die Zusammenarbeit mit
gewachsenen Neonazi-Strukturen in der Region angewiesen war, die
wiederum vom Verfassungsschutz mitfinanziert wurden. Viel zu oft bleiben
diese Zusammenhänge unerwähnt – und so bleibt die Legende der
isolierten Einzeltäter*innen bestehen.
Auf politischer Ebene wurden nach der Selbstenttarnung parteiübergreifend Aufklärung und Konsequenzen versprochen. Die meisten dieser Versprechungen haben sich als leere Phrasen erwiesen und müssen in den Ohren der Betroffenen wie blanker Hohn klingen. Zwar bieten die eingesetzten Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern einen Raum für die öffentliche Auseinandersetzung und haben auch erstaunliche Ergebnisse zu Tage gefördert. Allerdings bleiben viele zentrale Fragen weiterhin ungeklärt. Die Abschlussberichte der Untersuchungsausschüsse geben dem institutionalisierten Rassismus der Behörden nicht genug Gewicht, unter dem die Betroffenen auch nach den Anschlägen jahrelang gelitten haben. Dass die Kontinuität des gesellschaftlichen Rassismus auch nach der Selbstenttarnung des NSU ungebrochen ist, zeigen die aktuellen rassistischen Mobilisierungen im ganzen Bundesgebiet. Politiker*innen von CDU und CSU befeuern diese Debatten, indem sie heute wieder Verständnis für die „Sorgen der Bürger*innen“ zeigen, anstatt neue Bewegungen wie „HoGeSa“ und „Pegida“ zu verurteilen und zu bekämpfen. Hier wird mehr als deutlich, dass keine Lehren aus der rassistischen Gewalt der Vergangenheit gezogen wurden.
Gleiches gilt für die Sicherheitsbehörden. Die Verantwortlichen für
die rassistischen Ermittlungspraktiken wurden bis heute nicht in die
Verantwortung genommen. Im Bericht des Bundes-Untersuchungsausschusses
wird das Vorgehen der Polizei verharmlost, es wird weiterhin von
„Fehlern“ anstelle von institutionellem Rassismus gesprochen. Auch die
Kontakte zwischen Verfassungsschutz und Neonaziszene sind nach wie vor
eng. Die Frage, ob auch in Bezug auf den NSU Verbindungen verschleiert
werden, ist immer noch nicht geklärt. Stattdessen wurden die staatlichen
Sicherheitsstrukturen sogar noch weiter ausgebaut: Neben der
Aufstockung der Etats vieler Innenministerien wurde ein sogenanntes
„Bund-Länder-Extremismus-Abwehrzentrum“ eingerichtet.
Das alles zeugt nicht vom Willen, das Problem an der Wurzel zu packen
und noch nicht einmal vom Versuch, durch lückenlose Aufklärung das
verlorene Vertrauen der Betroffenen zurückzugewinnen.
Warum nach München und weiter?
Die juristische Aufarbeitung der Taten des NSU soll im Prozess in
München passieren. Ob das gelingen kann, bezweifeln wir – und dennoch:
Dies ist bisher der einzige öffentliche, vom Staat gegebene Raum, in dem
die Betroffenen des NSU eigene Forderungen stellen und ihre Perspektive
darlegen können. Doch selbst das wird ihnen sehr erschwert: Aus Sicht
des vorsitzenden Richter Manfred Götzl halten die Darstellungen der
Nebenkläger*innen und ihrer Anwält*innen nur den Fortgang des Prozesses
auf. Ihnen wird das Wort abgeschnitten, die Mitteilungen der Nebenklage
werden als unliebsame Störungen behandelt. Und das in unmittelbarer Nähe
zu den Neonazis, die sie am liebsten tot gesehen hätten.
Auch deshalb haben die Betroffenen auf der Keupstraße um
Unterstützung gebeten, wenn sie unter diesen schwierigen Bedingungen vor
dem Gericht in München aussagen sollen. Das Verhältnis zu staatlichen
Einrichtungen hat sich auch zehn Jahre nach dem Anschlag nicht
normalisiert, wie sollte es auch. Zu diesem Zweck, der solidarischen
Unterstützung, hat sich die Initiative „Keupstraße ist überall“
gegründet, der wir angehören. Am 20. Januar 2015 möchten wir mit
möglichst vielen Menschen nach München fahren, um die Betroffenen vor
Ort zu unterstützen.
Für uns als Antifa-Gruppe sind die geplanten Aktionen und die
Demonstration in München aus vielerlei Gründen wichtig. Wir wollen dort
unsere Forderung nach der Aufklärung des NSU-Komplexes – mitsamt der
Verstrickungen der Behörden – erneuern. Solange institutioneller und
gesellschaftlicher Rassismus aus der Diskussion ausgeklammert wird,
glauben wir nicht an eine Aufarbeitung. Solange Verfassungsschutz und
Nazis Hand in Hand gehen, können sich neonazistische Gewalttaten immer
wieder wiederholen. Und solange „das Volk“ lieber gegen Geflüchtete und
die angebliche „Islamisierung des Abendlandes“ hetzt, statt sich um eine
gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den eigenen rassistischen
Strukturen zu bemühen, wird auch niemand widersprechen. Wir wollen nach
München fahren, um diese Zusammenhänge aufzuzeigen, die unbequemen
Fragen erneut zu stellen und die bisher ausgebliebenen Konsequenzen
zusammen mit den Betroffenen einzufordern. Das Problem heißt Rassismus
und es löst sich nicht von alleine!
Wir wollen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Viel zu selten
gelang eine nachhaltige Zusammenarbeit mit den von rechter Gewalt
betroffenen Menschen. Wir müssen uns mit ihrer Perspektive beschäftigen,
und diese Auseinandersetzung führt uns nach München.
Im ganzen Bundesgebiet haben sich ähnliche Initiativen wie „Keupstraße
ist überall“ gegründet, um gesellschaftlichen Rassismus zu thematisieren
und Betroffene von rechter Gewalt vor Ort zu unterstützen. Gemeinsam
haben wir das bundesweite Aktionsbündnis „NSU-Komplex auflösen“
gegründet. Die Arbeit in der Initiative und diese bundesweite
Entwicklung haben uns noch etwas anderes gezeigt: Diese Arbeit kann nach
der Mobilisierung nach München nicht enden. Auch nach Ende des
Prozesses muss die Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex weitergehen,
am Besten in Zusammenarbeit mit Betroffenen des NSU. Die Annäherung
zwischen Antifaschistischen Initiativen und migrantischen Communities
wie denen der Keupstraße muss weiter ausgebaut werden, wir können nur
gemeinsam die kommenden Herausforderungen stemmen.
In diesem Sinne: Auf nach München. Und weiter.
Wie kann ich mit nach München kommen? Fahr mit uns mit dem Bus!
Alle nötigen Infos findest du hier: keupstrasse-ist-ueberall.de