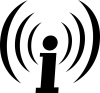Von Anne Lena Mösken Ein Platz für alle, die sonst nirgendwo einen haben: Die Bewohner der Cuvrybrache nennen ihn Freiraum, andere sehen nur die Armut. Wird die Cuvrybrache bald geräumt? Auf einer der letzten Freiflächen an der Spree in Kreuzberg planen die Bewohner den Widerstand.
Von wo werden die Polizisten kommen? Welchen Eingang werden sie nehmen? Den hinteren, wo die Cuvrystraße an der Spree endet? Den, von dem aus eine Gasse durch die Hütten der Roma führt? Oder den Eingang an der Schlesischen Straße, auf der die Partytouristen zwischen Bars und Clubs pendeln, wo ein Schild am Bauzaun lehnt, die Farbe darauf ist noch frisch: „Erst die Schule, jetzt die Cuvry? Die Räumung von Kreuzberg geht weiter.“
Die Cuvry. Eine Brache mitten in Kreuzberg. Beste Lage an der Spree. Lange war hier nichts, außer Gras. Jetzt wohnen hundert, zweihundert Menschen hier, so genau weiß das keiner, sie kommen und gehen, schlafen in Zelten und selbstgezimmerten Hütten. Manche sind kunstvolle Kleinode, mit Fenstern, abschließbaren Türen und Vorgärten, in denen Gemüse wächst. Vor anderen stapelt sich der Müll.
Berlins erste Favela, wurde die Brache genannt, ein Elendsquartier, ein Slum. Die, die hier wohnen, nennen sie Freiraum für alle, die sonst nirgendwo einen Platz haben. Aber dieser Platz gehört ihnen nicht, das ist das Problem. Er hat einen Besitzer, und der, das haben sie in der Zeitung gelesen, hat vor ein paar Tagen die Polizei um Hilfe gebeten. Wie schnell einem besetzten Ort in Kreuzberg die Räumung droht, haben die Menschen auf der Brache gerade in der Ohlauer Straße beobachtet. Und die Wege zwischen Cuvry, Görlitzer Park und Gerhart-Hauptmann-Schule sind kurz.
Deshalb sitzen die Bewohner Anfang vergangener Woche am Ufer zusammen, im schmutzigen Sand liegt eine weiße Platte: „Räumung“ haben sie mit Filzstift darauf geschrieben. Sie wollen vorbereitet sein. In den Tagen zuvor war das Gerücht aufgetaucht, auf dem Räumungsbescheid für die Schule wäre auch die Cuvry aufgelistet gewesen. Am Morgen waren Anwohner gebeten worden, ihre Autos in der Cuvrystraße umzuparken.
Was hat das alles zu bedeuten? Und wie kann man einen Ort verteidigen, auf dem schon das tägliche Leben oft ein Kraftakt ist? Weil mal wieder einer durchdreht, in der Nacht erst soll ein Mann mit einer Sense hinter einer Frau hergerannt sein. Es gibt keine Toiletten und kein fließendes Wasser, wer sich waschen will, muss in die Obdachlosenhilfe ein paar Straßen weiter gehen oder in die Spree springen; und überall die Ratten, die aus den Kellergewölben unter dem Gelände kriechen. Scheint die Sonne, stinkt es, wenn man dem Loch in der Mitte der Brache zu nahe kommt; Wolkenbrüche wiederum, wie es sie dieser Tage so viele gibt, legen das Leben komplett lahm.
In der Runde versuchen sie, die Kräfte zu bündeln. Gekommen sind vor allem die jungen Bewohner. Ihre Fingernägel tragen zwar Schwarz unter den Rändern, aber sie sehen nicht so verbraucht aus wie die, die schon länger unter freiem Himmel leben. Martina ist eine von ihnen, 23 Jahre alt, sie wohnt mit ihrem Freund in einer der Hütten mit Ofen und Gaskocher, zweimal in der Woche arbeitet sie in einem Café. Sie hätte eine Ausbildung machen können, aber sie wollte noch ein bisschen Freiheit. In Frankfurt, wo sie herkommt, hieß es: Freiheit, die gibt es in Berlin. Seit über einem Jahr lebt sie nun auf der Brache.
„Wir müssen die Eingänge verbarrikadieren.“ – „Was ist mit dem Ufer? Was, wenn die Polizei übers Wasser kommt? Werden wir genug Leute sein für eine Menschenkette?“ – „Vorräte besorgen.“ – „Nüchtern bleiben.“ – „Twittern.“ Ein Mädchen schreibt „# freecuvry“ auf die weiße Platte. Das Internet als Waffe, Tweets gegen Hunderte Polizisten. Es wird ein ungleicher Kampf. Auch weil es schwer ist, die Bewohner zusammenzubringen. Es klappt ganz gut, wenn es ums Essen geht, dann teilen sie, was sie aus Containern sammeln oder als Spenden von Bäckereien aus dem Kiez ergattern: Quark gegen Salami gegen Brot. Mehr Gemeinschaft gibt es kaum: Jeder kann kommen, jeder bleiben, keiner befindet darüber, was erlaubt ist. Es gibt keine Regeln auf der Cuvry, außer einer: Wenn du friedlich bist, passiert dir nichts. Und auch die gilt nur, bis sie jemand bricht.
Am Anfang saßen auch die Roma in der Runde, ihre Kinder rannten durch den Dreck, die Frauen tranken Sterni. Doch als eine Fotografin in die Runde knipste, stand ihr Anführer auf. „Keine Fotos.“ Ein Wink und alle stapften zurück in ihre Gasse. Nur einer ist geblieben. Neben ihm sitzt die Abgeordnete Canan Bayram von den Grünen, die gerade noch auf dem Dach der Schule zwischen Bezirk und Flüchtlingen vermittelt hat. Jetzt übersetzt sie.
Bayram kennt den Mann aus der Eisfabrik in der Köpenicker Straße. Ein Teil der Roma auf der Cuvry hat bis Ende des Jahres dort gelebt, bis die Polizei das Haus räumte. Damals hatten die Menschen nur ein paar Stunden Zeit, freiwillig zu gehen. Der Mann neben Bayram versteht die Aufregung nicht, er habe den Besitzer in München besucht, lässt er Bayram übersetzen, er werde sie rechtzeitig warnen, wenn es Zeit ist, zu gehen. Und wenn schon, sagt der Mann, seine Leute ziehen seit Jahren von einem Ort zum anderen. Ein Leben auf dem Sprung. Mit Freiheit hat das sowieso nichts zu tun.
Die Cuvry ist für jeden etwas anderes, jeder Moment hier steht für sich, weil der nächste schon wieder ganz anders ist. Mal ist die Cuvry ein Idyll. Dann fallen die Sonnenblumen am Rand der stinkenden Kuhle ins Auge, auf der Mauer löffeln junge Menschen mit hippen Brillen Eiscreme, zu ihren Füßen hält einer seine Angel in die Spree.
Mal ist die Cuvry Ort des Protestes, ist das Leben hier eine politische Haltung, eine Verweigerung gegenüber allem, was die Gesellschaft für das richtige Leben hält. Dann sind sie hier Teil einer globalen Bewegung, Gezi Park, Occupy Detroit, Free Gaza, Ohlauer Straße, Cuvry. Friede den Hütten.
Immer wieder aber liegt die Brache trostlos im Mittagslicht. Dann trifft man Flippi, Paule, Tibor, David. „Das hier ist der schönste Ort Berlins“, sagt Paule, der Mund zahnlos, die Haare dünn und grau, die Arme dünn und tätowiert, in der Hand eine Wodkaflasche, viertelvoll vom Vortag. Paule war 26 Jahre obdachlos, zwei davon verbrachte er auf der Brache, jetzt hat er eine Wohnung in Moabit und ist trotzdem jeden Tag hier.
Flippi, der mit dreizehn das erste Mal von zu Hause ausriss. Jetzt ist er 25, seine Hütte steht auf den Resten des alten Bunkers. Tibor, der aus Ungarn nach Deutschland kam, um als Metallbauer zu arbeiten. Dann ging vieles schief, er landete in der JVA Plötzensee wegen Schwarzfahrens, weil er die Frist, die Sache zu regeln, in den Armen einer Frau verschlief, sein Schlafplatz ist in einem der Tipis. David, der sich von den Eltern nicht mehr sagen lassen mochte, Junge, mach doch was aus deinem Leben. Er schmiss die Schule. Wenn er Geld braucht, schlendert er, die Gitarre geschultert, auf die Oberbaumbrücke, und spielt. Seit einem Tag hat er ein WG-Zimmer. „Ich musste weg“, sagt er. „Irgendwann wirst du hier…“ Er lässt den Finger neben dem Kopf kreisen. Irre.
Als die Krisenrunde tagt, steht Paule vor dem Kaisers in der Wrangelstraße, schnorrt für eine neue Flasche Korn; Tibor hält auf der Ufermauer ein Mädchen im Arm; David spielt am Eingang Gitarre; Flippi schleicht ziellos über das Gelände. Über ihnen braut sich ein Gewitter zusammen.